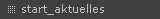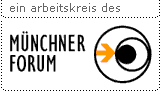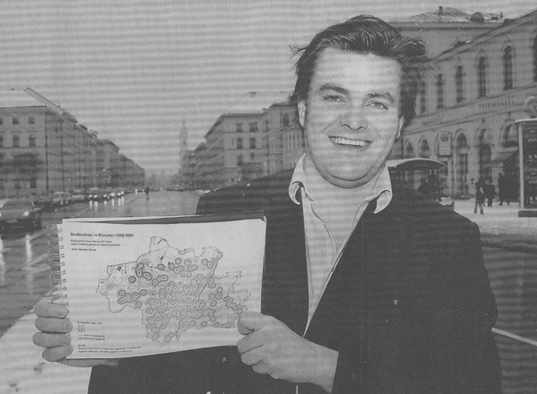| |
Süddeutsche
Zeitung, Münchner Neueste Nachrichten, 7.1.2004
Eine
Form für den sozialen Kitt
„Ereignis-Management“:
Geograph Benjamin David untersucht, wie sich Feste und
Proteste im öffentlichen Raum besser koordinieren lassen
Von Philip
Wolff
Ein Münchner
Stadtteil versinkt im Chaos. Demonstrationszüge zehntausender
Menschen kreuzen sich mitten in einem Straßenfest, dessen
Besucher bereits mit Freiluftkinogängern um eine freie
Asphaltfläche streiten. Ein Heer von Bladern muss am Rande
des Tumultes stoppen, Straßenbahnen und Autos geraten in Rückstau.
Nichts geht mehr, Ordnungskräfte fluchen. So könnte ein gewöhnlicher
Frühsommerabend im Jahr 2050 aussehen – wenn man die
Entwicklung der so genannten „organisierten Ereignisse im öffentlichen
Raum“ in München weiterrechnet: Um nahezu das Hundertfache
ist ihre Zahl in den vergangenen 30 Jahren gewachsen, weshalb
sich die Stadtverwaltung gern ein Management-System zulegen würde,
mit dessen Hilfe sie Zustände wie diese verhindern kann.
Tagesaktuelle Ereignis-Stadtkarten könnten die zuständigen
Beamten im Kreisverwaltungsreferat (KVR) dann abrufen,
Wochen-, Monatsübersichten und Ballungsorte, um die Masse der
Events räumlich und zeitlich zu entzerren. Eine Art Präventionssystem
gegen das Chaos.
Wenn
der Startschuss fällt
Die richtigen Zeitpunkte und Orte für Proteste oder Feste zu
bestimmen, wird für die Stadt und für Veranstalter zunehmend
schwierig. 2003 zum Beispiel galt als Rekordjahr der
Demonstrationen in München – ein gutes Jahr also für den
Geographiestudenten Benjamin David: Für seine Diplomarbeit
waren Zeit und Ort perfekt gewählt. Der 27-Jährige hatte im
vergangenen Frühjahr begonnen, am Seminar für
Sozialwissenschaftliche Geographie der Münchner Universität
(LMU) seine Abschlussarbeit über öffentliche Ereignisse in
der Landeshauptstadt zu schreiben. Wochenlang grub er sich
durch Datenbanken des KVR, recherchierte bei früheren und
heutigen Fest-Organisatoren und systematisierte, was sich seit
der Nachkriegszeit auf den Straßen Münchens alles abgespielt
hatte. Dazu fertigte er Karten an und formulierte Trends, die
den aktuellen Sorgen der Stadtverwaltung Nahrung gaben: „Es
ist immer mehr los in München“, fasst Benjamin David das
Fazit seiner Diplomarbeit zusammen. Nun soll seine Arbeit
Grundlagen liefern für ein Münchner Modellvorhaben: das
Anti-Chaos-System „Ereignis-Management“.
Das Planungsreferat zeigte Interesse an Davids Ergebnissen und
beantragte bereits im Sommer Forschungsmittel beim
Bundesbauministerium. Wäre das Projekt dort zurzeit nicht
wegen Geldmangels aufgeschoben, hätte Benjamin David sich zum
Jahresbeginn ein Büro einrichten und ein Firmenschild an die
Tür schrauben können. Nun beginnt er 2004 damit, eine
unbestimmte Zeit lang auf den Startschuss aus Berlin zu
warten. „Der wird bestimmt noch kommen, irgendwann“, sagt
er.
Gemeinsam mit Experten aus der Stadtplaner-Gruppe „Die
Urbanauten“, dem Planungsbüro 504 und dem
Sozialgeographischen Seminar der LMU will Benjamin David
Strategien gegen ein künftiges Wirrwarr der Events in München
entwerfen. Die ersten groben Züge stehen bereits: „Man muss
sich einerseits zeitlich aus dem Weg gehen“, sagt er. „Im
August etwa gibt es auf den Straßen zehn Prozent weniger
Verkehr, und 90 Prozent der Bevölkerung sind in der Stadt.“
Warum also im Juni oder Juli Proteste, Feste oder Märkte
beantragen und genehmigen? Juni und Juli sind Ballungsmonate.
„Vor allem aber kann man sich räumlich besser in München
verteilen als bisher“, sagt Benjamin David. Das
Verkehrsaufkommen und die Umgehungsmöglichkeiten der
Ludwigstraße etwa legten nahe, „sie häufiger zur Fest- und
Flaniermeile auf Zeit“ zu machen. Damit entstünden neue
Gelegenheiten für zentrale Events, mit denen die Fußgängerzonen-Achse
der Innenstadt derzeit überladen sei. Aber auch Straßenzüge,
etwa im Westend oder in Haidhausen, „in denen pro Stunde nur
ein einziges Auto fährt“, eigneten sich als neue Orte für
„Feste, Märkte und Proteste“ – so lautet im übrigen
Davids Diplomarbeitstitel.
Im Terminplan hingegen gibt es nach Davids Analyse für die
organisierten Ereignisse in München kaum Ausweichmöglichkeiten.
Ein Jahr zählt demnach fast 6000 Veranstaltungstage, jeder
Tag ist im Durchschnitt mehr als 16-fach belegt: Demos am
Stachus, Infostände auf dem Marienplatz, dazwischen Straßenmusiker,
ferner Flohmärkte, Nachbarschaftsfeste, die Summe ist schnell
beisammen – und sie erhöht sich von Jahr zu Jahr mit
wachsender Geschwindigkeit. Was sich also auch erhöhen müsste,
wäre die Zahl der Veranstaltungsorte: „Wir könnten da zum
Beispiel von Paris lernen“, schlägt Benjamin David vor.
Zum zweiten Mal hatte die rotgrüne Pariser Stadtregierung im
vergangenen Sommer drei Kilometer Straße entlang des rechten
Seine-Ufers für den Verkehr gesperrt und zum öffentlichen
Veranstaltungsraum gemacht: zum Strand, Paris Plage, mit Künstlern
und Buden. Chaos auf den Umgehungsstraßen gab es in der
verkehrsberuhigten Ferienzeit nicht. „Oder wir lernen von
Barcelona“, sagt Benjamin David. Dort war ihm während eines
Auslandssemesters die Idee zum Diplomthema gekommen – als er
sah, wie die Ramblas, Plätze, Straßen und Märkte lebten,
ohne dass die zeitweise ausgesperrten Autofahrer sonderlich in
Zeitnot gerieten. „Um das klarzustellen: Es wird in München
nicht darum gehen, Straßenfeste gegen den Autoverkehr
auszuspielen“, sagt er. „Es geht allein um das richtige
Management.“ Während dafür jedoch in Barcelona eigens ein
„Entwicklungsplan öffentlicher Raum“ existiere, „haben
wir in München nur einen Verkehrsentwicklungsplan“. Feste,
Märkte und Proteste aber forderten in München zusehends
planerische Beachtung, „ein neues Bewusstsein“, sagt
David.
„Wir Urbanauten“
Das Bewusstsein, das der angehende Stadtplaner einfordert, ließe
sich auf die Formel bringen: Die Münchner sollten ihre Stadt
mehr als Lebensraum begreifen denn als Straßensystem, das man
zur anonymen Durchfahrt und Erledigung des Alltags benutzt.
„Wir Urbanauten haben zum Beispiel im vergangenen Herbst die
,Fête de la musique‘ in der Hohenzollernstraße
veranstaltet. Dabei ging es darum, dass Anwohner mit ihren
Musikinstrumenten auf die Straße gehen und zusammen
spielen“, berichtet Benjamin David.
Solche Ideen
entsprechen nicht ganz dem Trend des öffentlichen
Veranstaltungswesens, den David in seiner Diplomarbeit
dokumentiert hat. Demnach haben vor allem
Massenveranstaltungen Konjunktur: Waren die ersten Straßenfeste
in München Anfang der 70er Jahre noch kleine, politische
Nachbarschaftstreffen gegen Luxussanierung oder die
autogerechte Stadt, gibt es heute rund 50-mal so viele
Zusammenkünfte: 150 zum Großteil professionell aufgezogene
Feste mit bis zu vielen tausend Gästen. An Masse und
Professionalität zugenommen hätten ebenso die Wochenmärkte,
sagt David, die in den späten 60er Jahren in
Stadtrandvierteln eingeführt wurden. Sie wuchsen bis heute
auf das 40-Fache. „In den Neunzigerjahren übernahmen dann
Eventagenturen viele Veranstaltungen. Dazu kamen neue Events für
die Massengesellschaft: die Bladenight, das Kino Open Air . .
.“ Doch David will keinen eigenen Trend dagegen setzen.
„Alle diese Ereignisse“, sagt er, „sind der soziale
Kitt, der unsere Stadt zusammenhält.“ Vorausgesetzt, sie
ufern nicht ins Chaos aus. Und werden beizeiten gemanagt. Spätestens
im Sommer 2050.
Wir
danken dem Autor für die freundliche Genehmigung zur
Wiedergabe des Artikels auf www.urbanauten.de.

|
|
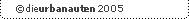 |