
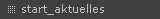 |
 |
 |
|
|
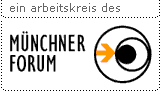
|


Pamphlet #17, nach dem debatten_gelage am 18.10.2004
Orte der Erinnerung: das geschichtliche Bewusstsein der Öffentlichkeit +++ Privatinitiativen des Erinnerns: Provokationen an einen konstruktivistischen Geschichtenerzähler? +++ Der Fokus auf dem Widerstand: lässt uns die Stadt die NS-Zeit vergessen? +++ Der öffentliche Raum als Kulisse - die Stadt als Manipulator der Öffentlichkeit +++ Stolpersteine in München - Stolpersteine für die Stadtherren? +++ Die "Hauptstadt der Unbewegung": Revisionismus oder Plädoyer für Normalität
"Bau
und Nutzung, Zerstörung und Veränderung von Denkmälern und
Gedenkstätten sind demnach ein wichtiger Bereich symbolischer
Politik und der durch sie beeinflussten Gedächtniskultur.
Ihre Träger und Akteure wollen dabei ein zeit- und
gruppenspezifisches oder gruppenübergreifendes Geschichtsbild
festschreiben und den Erinnerungsdiskurs entweder
zentralisieren oder umgekehrt gerade lokalhistorisch
fixieren."
Peter
Reichel 1995: Steine des Anstoßes. Der Nationalsozialismus im
kollektiven Gedächtnis der Westdeutschen. In: François, E.
et al. (Hrsg.), Nation und Emotion,
S.169
Der
öffentliche Raum kann als Bühne verstanden werden, auf der
politische Ideen räumlich kristallisiert werden. Dies wird
besonders deutlich im Bereich der Erinnerungs- und
Geschichtspolitik. Denn Monumente, Denkmäler, Plätze und
vieles mehr sind nicht nur materielle Artefakte, sondern
transportieren auch immer Ideen ihrer Errichter mit. Insofern
wird im öffentlichen Raum bewusst "Geschichte
geschrieben". Es stellt sich jedoch die Frage, wer an
dieser "Geschichtsschreibung" teilhaben darf?
In
München sorgten in letzter Zeit unterschiedliche
Erinnerungsprojekte für Schlagzeilen. Die
"Stolpersteine" des Künstlers Gunter Demnig, die
vor den Häusern deportierter Juden verlegt wurden, oder der
"Brandfleck" von Wolfram Kastner auf dem Königsplatz
zur Erinnerung der Bücherverbrennung, haben gezeigt, dass
Stadtobere - hier als Vertreter eines abstrakten Staates
verstanden - der Inflationierung der Erinnerungsstätten (C.
Ude) entgegen wirken wollen. Da Stadt München und Freistaat
Bayern jedoch an eigenen Erinnerungsstätten arbeiten (so z.B.
am NS-Dokumentationszentrum) stellt sich die Frage, warum
privaten Initiativen Stolpersteine in den Weg gelegt werden?
Strebt der Staat nach einem Erinnerungsmonopol?
Interessant
erschient die Beobachtung, dass die Erinnerungslandschaft für
die NS-Herrschaft in München zum großen Teil auf Gedenkstätten
für Widerstandskämpfer beruht. Welche Wirkungen hat diese
Herausstellung?
Soll
den wenigen Leuchttürmen der NS-Zeit gedacht werden, um die
Schrecken endlich selbst "vergessen" zu dürfen?
Sollen die Erinnerungsorte des Widerstandes uns zeigen, dass
diese Möglichkeit der Widersetzung und des Freiheitskampfes
bestand - nach dem Motto: Möget Ihr es Ihnen nach machen?
Thesen
aus d
1.
Der Staat: revisionistischer Geschichtsmonopolist oder Ermöglicher
bundesdeutscher Normalität?
Ist
dem Staat tatsächlich Bösartigkeit zu unterstellen, uns das
allgegenwärtige Gedenken an die Schrecken des
Nationalsozialismus zu ersparen? Oder vollzieht er nun
heimlich oder selbstbewusst die lange geforderte "Rückkehr
zur Normalität" (F.-J. Strauß), um den ewigen
Schuldkomplex der Deutschen zu lindern?
Bösartigkeit
ist dem Staat, den Stadtoberen sicherlich nicht zu
unterstellen. Von Revisionismusverdacht ganz zu schweigen.
Politiker und sonstige Entscheidungsträger haben Deutschlands
schwere Schuld stets eingestanden - beinahe verstaatlicht.
Dennoch geht es nicht um die Normalisierung des deutschen
Selbstbildes. Dies setzt schließlich voraus, dass das
deutsche Selbstbild zuvor von Schuldkomplexen geradezu geplagt
war.
Die
These: Die Deutschen litten nicht unter Schuldkomplexen,
deshalb kann es auch nicht Absicht sein, die Deutschen von
ihrer Täterrolle zu erlösen.
Denn
ist es nicht eher so, dass die Deutschen hinter einem
verstaatlichten Schuldbekenntnis in eine private Opferrolle
geschlüpft sind?
In
den Jahren nach 1945 konnte man überall hören, dass man
Opfer des Systems, der Nazi-Herrschaft war. Dies war die
emotionale Empfindung des kleinen Mannes, wurde jedoch z.B.
auch selbstbewusst in den Nürnberger Nachfolgeprozessen von
den Verantwortlichen der IG Farben vertreten.
Seit
der Wiedervereinigung wurde diese Opferrolle durch eine andere
verdrängt - ohne behaupten zu wollen, diese wäre zuvor nicht
thematisiert worden: Wir Deutschen waren Opfer von Flächenbombardements
und Vertreibung. Dabei waren dies nicht (nur) Themen der neuen
Rechten: Auch Günter Grass als linker Staatsintelektueller
hat sich dem Thema im Krebsgang angenähert.
Doch
damit scheint die Frage, welche Interessen der Staat verfolgt,
weiter offen!
2.
Der Staat als Manipulator - der Normalfall?
Es
stellt sich die Frage, ob es nicht ganz normal ist, dass der
Staat Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes prägt. Und
warum sollten wir so stark an unsere negativen Seiten der
Geschichte erinnern, wenn andere es gar nicht tun?
Die
Außerordentlichkeit der deutschen Vergangenheit sollte schon
zu besonderer Sensibilität mahnen. Doch kritisch ist die
allgemein normative Perspektive erst im zweiten Schritt: Wie
kann der Staat optimal Geschichte schreiben?
Zuerst
sind vielmehr die positiven, real geschehenen, Konfrontationen
problematisch: Was ist von einem Staat zu halten, der Erinnern
predigt, es aber nicht zulässt - noch dazu wenn die
Intervention sich auf den Bereich der Schulbildung und Schülerinitiative
bezieht, wie bei den Stolpersteinen?
Die
These: Der Staat will verklären anstatt aufklären.
3.
Der Staat - Bewahrer eines ausgeglichenen öffentlichen
Raumes?
Werden
private Erinnerungsmanifestationen zugelassen, so könnten Tür
und Tor für Gedankengut geöffnet werden, das die
demokratische Gesellschaft im Öffentlichen Raum nicht sehen
will. Falls Stolpersteine erlaubt werden, müssen dann auch
Mahnwachen von Neonazis zugelassen werden?
Diese
Frage betrifft die Konstitution der demokratischen
Gesellschaft. Öffentliche Meinungs- und Versammlungsfreiheit
werden in der Bundesrepublik - nicht zuletzt durch die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes - als extrem
wichtige Güter geschützt. Das ist sehr zu begrüßen. Zum
prinzipiellen Schutz der Grundrechte - die nicht selektiv
gebraucht werden dürfen - kommt die Überlegung, dass rechtes
Gedankengut durch Verbote nicht zu konterkarieren ist. Es gibt
also von dieser Seite gar keine Beschneidungsmöglichkeit der
Exekutive für Versammlungen und ähnlichem. Nun handelt es
sich bei Gedenksteinen und Mahnmalen jedoch um permanente
Zeichen. In der Debatte wurde deshalb gefordert, Staat und
Stadt sollten für politisch korrekte und angemessene
Symbollandschaften im öffentlichen Raum sorgen. Diese
Einstellung folgt der Organtheorie, mit der Platon und
Aristoteles den Staat als "guten Lenker" definieren.
Hier spätestens wird deutlich, dass die Frage des öffentlichen
Erinnerns eine Frage der Demokratie- und Staatsdefinition ist.
Denn folgt man eher den Staatsdefinitionen in der
sophistischen Tradition der Vertragstheorie, so ist der Staat
ein Zweckbündnis und die Regierungen sollen den Willen des
Volkes vertreten.
Das
Problem liegt nun darin, dass der organtheoretische Ansatz
Ansatzpunkte für Willkür bietet. Der Staat sollte vielmehr
als "Ermöglicher" von Privatinitiativen auftreten
und diese einem demokratischen Prozess zuführen! Das bedeutet
nicht zwangsläufig, dass für jedes Mahnmal ein Volksbegehren
durchzuführen sei. Es existieren auch andere Instrumente, wie
etwa Bürgersprechstunden - die sich besonders bei der
dezentralen Problematik der kleinen Erinnerungsstätten
anbieten. Falls die Konzeption der demokratischen
Output-Legitimation akzeptiert ist, könnten auch
Expertengremien zu einer Lösung beitragen.
Die
These: Staat und Stadt sollen als "Ermöglicher"
auftreten und Projekte einem demokratischen
Entscheidungsprozess zuführen. Willkür im
Entscheidungsprozess ist nicht hinzunehmen, da Machtworte und
Unterdrückung von Gegenmeinungen den Verdacht der persönlichen
Interessenverfolgung aufwerfen.
4.
Der provozierende Staat
Dient
ein Verbot der genannten Privatinitiativen nicht eher einer
Schaffung der Öffentlichkeit? Immerhin rollte eine Lawine von
Leserbriefen über die regionale Zeitungslandschaft!
Dazu
sollen zwei Punkte angesprochen werden:
Zum
ersten wollen wir den Fokus auf den öffentlichen Raum legen,
insofern wäre ein öffentlich zugänglicher Stolperstein als
Erinnerungsmarke auch ein alltäglicher Denkanstoß - die
Themenbesetzung in der medialen Öffentlichkeit hingegen ist
bereits abgeklungen.
Zum
zweiten ist eine Schaffung von Öffentlichkeit immer zu begrüßen.
Eine Provokation des Staates wäre als "Denkanstoß"
sogar überlegenswert.
Doch
hier trifft dies gar nicht zu, denn der Denkanstoß war ja
bereits initiativ gegeben worden - es handelt sich also gar
nicht um ein Thema, bei dem der Staat provozieren muss, damit
sich überhaupt jemand damit auseinander setzt.
Darüber
hinaus verlangte eine solche Provokation natürlich auch, dass
die anschließende Debatte mit offenem Ausgang geführt wird.
Eine Initialzündung mit vorgegebenem Ergebnis ist sinnlos und
kontraproduktiv.
Die
These: Der Staat will nicht das Erinnern provozieren, sondern
lenken.
Alexander
Danzer