
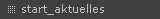 |
 |
 |
|
|
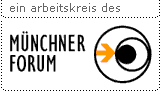
|

Vortragsreihe
DIE RENAISSANCE DES ÖFFENTLICHEN
RAUMES
IN DER EUROPÄISCHEN STADT
Aktuelle Debatten, Konzepte & Projekte aus Italien, Spanien, der Schweiz und Großbritannien
Der öffentliche Raum erlebt
eine Renaissance. Auch die wissenschaftliche
und planerische Auseinandersetzung mit den Plätzen und Parks
unserer
Städte hat zur Zeit Konjunktur. Für unsere Vortragsreihe
konnten wir einige der spannendsten Experten zum Themenfeld öffentlicher
Raum gewinnen, die über neueste Entwicklungen des öffentlichen
Lebens aus Italien, Spanien, der Schweiz, Deutschland und Großbritannien
berichten werden.
Donnerstag,
13. 1. 2005
Die
Wiedergeburt öffentlicher Räume in Italiens historischen Städten
Prof. Bernhard Winkler
Donnerstag,
20. 1. 2005
Urban
Renaissance: Die Wiederkehr des öffentlichen Raums in Cool
Britannia
Prof. Harald Bodenschatz, TU Berlin
Donnerstag,
27. 1. 2005
terrain
vague – füllen und leeren. Spanien
Jochem Schneider, bueroschneidermeyer, Stuttgart
Donnerstag, 3. 2. 2005
Die erotische Dimension des Städtischen. Die
Schweiz
Prof. Ernst Hubeli, TU-Graz
![]()
veranstaltet von den_urbanauten und der Münchner Geographischen Gesellschaft in Kooperation mit dem Münchner Forum e.V., dem Baureferat der Landeshauptstadt München, dem Lehrstuhl für Städtebau und Regionalplanung an der Fakultät für Architektur der Technischen Universität München und dem Department für Umwelt- und Geowissenschaften/Sektion Geographie der LMU
Idee & Anlass
Wo wollen wir hin mit dem öffentlichen Leben in München? Was für öffentliche Räume brauchen wir dafür in Zukunft? In München fehlt eine breit angelegte Debatte über diese und ähnliche Fragen. Andere europäische und auch deutsche Städte sind hier schon weiter – seien es Barcelona, Lyon, Hannover, Stuttgart oder Berlin. Die Münchner Geographische Gesellschaft hat dies zum Anlass genommen, zusammen mit den urbanauten im Winter 2005 einen Themenblock ihrer Serie von Diskussions- und Vortragveranstaltungen dem öffentlichen Raum zu widmen.
Ziel des Themenschwerpunkts ist es, öffentliche Räume in verschiedenen Städten des europäischen Auslandes vorzustellen und dabei unterschiedliche Herangehensweisen für den öffentlichen Raum der jeweiligen Städte aufzuzeigen. Dabei stehen nicht Aspekte der architektonischen Gestaltung im Vordergrund, sondern gesellschaftliche Fragestellungen.
In der Diskussion werden anschließend die Thesen des Vortrags vor allem auf ihre Bedeutung für München hin diskutiert. So sollen Anregungen zu einem möglichen „Entwicklungskonzept öffentlicher Raum für München“ gewonnen werden. Ein solches entwickeln die_urbanaunten bereits – zur Zeit noch als Gedankenspiel.
Department für Umwelt- und Geowissenschaften, Hörsaal 4 (1. Stock), Luisenstraße 37
jeweils Donnerstag, 13. Januar, 20. Januar, 27. Januar und 3. Februar 2005, 18.30 – 20.00 Uhr
Verkehrsverbindungen: U2 - Haltestelle Königsplatz, Ausgang Königsplatz
Referent: Prof. Dipl.-Ing. Bernhard Winkler
Donnerstag,
13. 1. 2005
18.30 Uhr im Department für Umwelt- und
Geowissenschaften, Hörsaal 4 (1. Stock), Luisenstraße 37
Das
Reizthema "Stadt und Verkehr" wird unter dem
Gesichtspunkt des öffentlichen Lebens am Beispiel
italienischer Städte dargestellt. Dabei geht es um die
Wiedergewinnung städtischen Raumes durch die Reduzierung des
exzessiven Autoverkehrs in den Städten.
Wie viel Verkehr verträgt die Stadt und wie verfremdet dieser
Stadträume ? Es werden Lösungsansätze vorgestellt, die
neben technischen Möglichkeiten vor allem auf ein verändertes
Verhalten der Menschen mit ihrem Raum hinarbeiten.
Bernhard Winkler wird anschaulich von seinen Erfahrungen mit
historischen Städten Italien berichten, dort war er jahrelang
an der Umgestaltung und Forschung der öffentlichen Räum
beteiligt. Es kam zu einer Renaissance es des öffentlichen
Lebens und zu neuen Ideen die Stadt vor dem Verkehrsinfarkt zu
schützen.
Referent: Prof. Dr. Harald Bodenschatz, TU Berlin
Donnerstag, 20.
1. 2005
18.30 Uhr im Department für Umwelt- und
Geowissenschaften, Hörsaal 4 (1. Stock), Luisenstraße 37
Verfall oder Renaissance des öffentlichen Raums? Für beide Positionen sprechen gewichtige Argumente. In der Tat verändert sich der öffentliche Raum erheblich – nicht zuletzt in den Zentren der großen Städte. Das betrifft die Formen, die Nutzungen, die rechtlichen Verhältnisse, die Verhaltensregeln, die Überwachung und vor allem die sozialen Adressaten der öffentlichen Räume. In England etwa ist diese Entwicklung schon weiter vorangeschritten als in Deutschland.
Harald Bodenschatz wird anhand aktueller Entwicklungen in englischen Großstädten die Probleme und Chancen neuer Formen von öffentlichen Räumen diskutieren. Dabei wird auch auf die US-amerikanische Städtebaureformbewegung des New Urbanism Bezug genommen. Hintergrund seiner Darstellung sind umfangreiche Forschungen in USA und England.
Referent: Dipl.-Ing. Jochem Schneider, bueroschneidermeyer, Stuttgart
Donnerstag,
27. 1. 2005
18.30 Uhr im Department für Umwelt- und
Geowissenschaften, Hörsaal 4 (1. Stock), Luisenstraße 37
Begriffe wie „Offenheit“ und „Unbestimmtheit“ bestimmen in den letzten Jahren die Debatte um Öffentliche Räume in Deutschland und Europa. Wie kann Gestaltung im Stadtraum in einer Gesellschaft stattfinden, deren Rituale sich in immer kürzeren Halbwertszeiten verändern? Die Frage nach dem Umgang mit den öffentlichen Räumen spielt in Barcelona seit dem Beginn der 1980er Jahre, der Zeit der „transición“ zwischen Diktatur und Demokratie, eine zentrale Rolle. Bis heute dienen neue Plätze und Parks als Symbol des gesellschaftlichen Wandels und Instrument einer weitreichenden Profilierung der Metropole im internationalen Städtewettbewerb. Großveranstaltungen fungieren als Motor der Stadt- und Freiraumentwicklung – nicht ohne breite Debatten über eine zeitgemäße Form öffentlicher Räume und deren sozialer Bedeutung anzustoßen.
Ausgehend von diesen Entwicklungen und Erfahrungen schafft Jochem Schneider Verbindungen zu der aktuellen Planungsdiskussion um öffentliche Räume in Deutschland. In der Studie „Plätze, Parks und Panoramen“ wurden für Stuttgart vier Leitthemen für eine zukunftsgerichtete Strategie zur Aufwertung der innerstädtischen Freiräume entwickelt und in ein Aktionsprogramm eingebunden. Die Neustrukturierung der öffentlichen Räume an der Schnittstelle zwischen Innenstadt und Hafen bildet im Projekt „Quartiersentwicklung Jungbusch Verbindungskanal“ die Grundlage für einen umfassenden Stadtumbauprozess.
Referent: Prof. Dipl.-Ing. Ernst Hubeli, TU-Graz
Donnerstag, 3. 2. 2005
18.30 Uhr im Department für Umwelt- und
Geowissenschaften, Hörsaal 4 (1. Stock), Luisenstraße 37
Der Vortrag wird eine Einführung über den Strukturwandel der Öffentlichkeit behandeln und mögliche Schlussfolgerungen für den öffentlichen Raum skizzieren. Anschließend werden die Thesen mit Beispielen aus der Schweiz zu veranschaulicht.
Der Planung von öffentlichen Orten sind Ungewissheiten immanent. Zurückhaltung in ihrer funktionellen und gestalterischen Determinierung ist geboten. Jede Planung erweist sich als Sonderfall mit unterschiedlich ins Gewicht fallenden ästhetischen, organisatorischen und sozialen Momenten. Stadträume und Plätze sind in ein räumliches Kontinuum einzubinden, um eine Abfolge von unterschiedlichen Orten und Infrastrukturen anzubieten, deren Nutzung und soziale Kodierung möglichst offen bleiben. Diese städtebauliche Voraussetzung für die Entstehung von Teilöffentlichkeiten ist zugleich eine These dieser Forschungsarbeit: Im Unterschied zur medial hergestellten Öffentlichkeit stellen sich Teilöffentlichkeiten selbst her.