
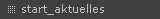 |
 |
 |
|
|
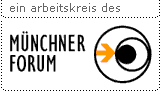
|



Pamphlet #1, nach dem debatten_gelage am 9.12.2002
+++ vom Mobilitätsraum zum Aufenthaltsraum +++ und zurück
+++ von der Privatkapsel Auto zu einer gesellschaftlichen
Interaktionskultur +++
I.
Zur Einführung
Als Pamphlet wird gemeinhin eine Kampfschrift bezeichnet, manchmal abwertend auch eine „Schmähschrift“. Der Beschluss, Pamphlete zu verfassen, entspringt dem philosophischen und bisweilen revolutionären Gedankengut, welches in unserem Münchner Kreise gar heiter, nie jedoch ohne die erforderliche Ernsthaftigkeit diskutiert, erörtert und entwickelt wird.
Somit sei dieses erste Pamphlet der großartigen Zusammenkunft unverbrauchter junger akademischer Freidenker und Schöngeiste gewidmet, die sich des Gemeinguts Aller, insbesondere aller Stadtbewohner – des öffentlichen Raumes – angenommen haben.
Ihr Objekt sei das Verhalten der Menschen in der Öffentlichkeit, wobei besonderes Augenmerk der Fortbewegung im öffentlichen Raum zukommen soll. Titel des Pamphlets sei „Wider die Sprachlosigkeit der Individuen“.
II. Eine These des Abends
Zunächst möchte ich, auch um dem Leser den theoretischen Hintergrund der Thematik darzulegen, auf die These des Kollegen David rekurrieren.
In dankenswerter Weise graphisch und mit einigem Wortwitz aufbereitet, elaboriert David das grundlegende Problem der Definition des öffentlichen Raumes anhand verschiedener Begriffe entlang eines von ihm als Kontinuum bzw. Mischform bezeichneten und die Aspekte des Raumes kategorisierenden Leitfadens[1]. Gestützt auf die Annahme, der öffentliche Raum sei durch seine jeweilige Eigenart als Bewegungsraum respektive als Aufenthaltsraum charakterisiert, gipfelt Davids These in nuce darin, die im Raum verbrachte Zeitspanne bedinge die Nutzungsmöglichkeit und schließlich auch die qualitative Wertigkeit des Raumes. Er folgert daraus, der als qualitativ hochwertig anzusehende Teil des öffentlichen Raumes, der seine besondere Qualität vor allem aus den klassischen Begegnungs- und Kommunikationsmöglichkeiten im Raum gewinne, müsse in den als bloßen Mobilitätsraum genutzten Teil des öffentlichen Raumes „ausgedehnt“ werden. Letzteres umfasst sowohl die rein räumliche, als auch die zeitliche Dimension sowie deren wechselseitiges Wirkungsgefüge.
III. Wider die Sprachlosigkeit der Individuen
Nicht einhellig, wenn auch nicht gerade in Minderheit wurde die Ansicht des Kollegen David geteilt und erörtert.
Die befürwortende Seite vertrat den Standpunkt, ein Platz ziehe seine Bedeutung aus der Interaktion der Nutzer, die durch den Platz selbst offeriert, ja bisweilen induziert oder gar forciert würde.
Demgegenüber wurde als gewichtiges argumentum e contrario angeführt, da die Nutzer tatsächlich den Raum entsprechend ihren Bedürfnissen nutzten, widerspräche eine Verallgemeinerung der Davidschen These dem volontée generale, der sich hier gerade in der Mobilitätsfunktion manifestiere[2].
Weiter gesponnen ergibt sich daher ein plakativ dargestellter Widerstreit zwischen „Der Weg ist das Ziel“ und „Der Weg ist im Weg“.
Soll der öffentliche Raum als Mobilitätsraum planerisch besser inszeniert werden oder die durch schnelle Fortbewegung zum Zwecke A nach B bedingte kurze Aufenthaltszeit im Raum zugunsten eines klassischen Interaktionsraumes „entschleunigt“ werden?
Während Kollegin Schröppel – treffend wie ich meine – festellte, gerade der Schutz der „Privatkapsel“ Auto ermögliche zumindest eine bedingte Kontaktfreude[3], äußerte Kollege Zöller sein Missfallen über die fehlende, ja geradezu flüchtend vermiedene Interaktion von Individuen, die sich in einem Mobiltätsraum (z.B. in einer U-Bahn oder dem dazugehörigen Bahnsteig) zusammenfänden[4]. Aufgedeckt und in der Folge beinahe einstimmig angeprangert wurde die Sprachlosigkeit der Individuen, die – eigentlich gar nicht privat, sondern vollkommen öffentlich – zusammen in einem Mobilitätsraum eine gewisse Zeit eben nicht mit-, sondern nur nebeneinander verbrächten. Hierzu wurden von allen Kollegen mehrere illustrative Begebenheiten geschildert, die gesondert nachzulesen sein werden[5]. Gefordert wurde ein Wandel in der gesellschaftlichen Interaktionskultur, die der spontanen oder auch geplanten (z.B. eventisierten) öffentlichen Situation auch gerecht werde und die selbst auferlegte Sprachlosigkeit der Individuen durchbreche[6]. Damit könne der Raum seine öffentliche Funktion und schließlich seine Attraktivität (zurück-)gewinnen.
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der an diesem Abend[7] schwerpunktmäßig behandelte mobilitätsgeprägte öffentliche Raum oftmals das Prädikat „öffentlich“ gar nicht verdienen kann und dass eine besondere Aufmerksamkeit in der Planung ebenso notwendig wäre wie eine bewusstere Interaktionssozialisation zwischen den Individuen, die ja eigentlich eine raumbedingte gemeinsame Öffentlichkeit formieren könnten.
Martin Klamt
1.
Freude
und Ablehnung über einen Musikanten in einer Berliner
U-Bahn, der so zumindest für die Dauer der Fahrt zwischen
zwei Haltestellen aus der anonymen und privaten Öffentlichkeit
gemeinsame Öffentlichkeit erzeugt.
2.
Zwei
abgehalfterte Alt-Nazis, die in der Münchner U-Bahn über
mehrere Stationen ungehindert ausländisch aussehende
Fahrgäste mit üblen Bemerkungen belegen, während die übrigen
Fahrgäste die Unkultur des Weg- und Zusehens in sträflichster
Weise zelebrieren.
3.
Spontane
Öffentlichkeit und gemeinsame Identifizierung im Sinne
eines Gruppengefühls beim Singen von DJ Ötzi’s „Hey
Baby“ nach einem Oktoberfestbesuch in der Münchner
U-Bahn aus tausend betrunkenen Kehlen gleich welchen
Alters, Geschlecht oder Schicht.