
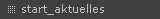 |
 |
 |
|
|
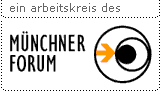
|



Pamphlet #2, nach dem debatten_gelage am 13.1.2003
+++
öffentliches Leben als Improvisationstheater +++ extreme
Rollen ermöglichen Begegnung +++ Gegensätze machen öffentlicher
Raum lebendig +++
Nach dem Verlesen des Pamphlets Nr. 1 des Kollegen Klamt entfachte erneut die Diskussion über die Öffentlichkeit im Mobilitätsraum.
Die erzwungene Enge, beispielsweise in der U-Bahn wurde nicht übereinstimmend als positiv oder kommunikationsfördernd oder gar öffentlich betrachtet. Freiwillige Enge hingegen, beispielsweise im Biergarten, bietet oftmals die Möglichkeit zur Kommunikation.
Große Übereinstimmung herrschte bei der Vermutung, dass ein unvorhergesehenes Ereignis die Beteiligten in Interaktion treten lässt. Hierzu wurden mehrere Beispiele angeführt. Zwei stellvertretend: Die U-Bahn die im Tunnel stehen bleibt oder der Fahrstuhl der stecken bleibt. Zu letzterem sei auf einen Sketch von Anke Engelke und Olli Dietrich hingewiesen.
Aus dieser Debatte heraus entstand eine lebhafte Diskussion über die Rolle des einzelnen in der Öffentlichkeit. Dabei kristallisierte sich die Vermutung heraus, je extremer die Rollen, der Status etc. der einzelnen Personen auseinander liegen, desto spannender / lebendiger ist der öffentliche Raum. Jede Person spielt im öffentlichen Raum eine Rolle, zelebriert ihre Rolle und befindet sich in einem ständigen Improvisationstheater.
Hier müsste sich meiner Meinung nach noch die Debatte um Kommunikation, Interaktion und Verhalten von Individuen und Gruppen im öffentlichen Raum anschließen.
Der zweite Diskussionsblock drehte sich um soziale Brennpunkte in der Stadt. Es stand die Frage im Raum, ob nicht wohlhabende, segregierte „Ghettos“ ein viel größeres Defizit an sozialen und nachbarschaftlichen Kontakten besitzen, als die sogenannten Stadtviertel mit sozialen Schwierigkeiten. Ein Indiz dafür könnte sein, dass es in den wohlhabenden Vierteln weniger oder gar keine Straßenfeste in den letzten Jahren gab. Also lieber die soziale Stadt für Grünwald als fürs Hasenbergl?