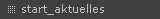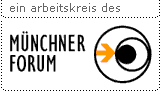|
+++ Konsum einer ästhetisierten Stadt +++ private öffentliche
Räume bieten psychologische Sicherheit +++
Ausdifferenzierung der öffentlichen Räume für verschiedene
Teilöffentlichkeiten +++ findet jeder seinen Raum? +++
„guter“ öffentlicher Raum lässt Freiheit und macht
demokratiefähig +++
Nach den Erläuterungen
zu Pamphlet Nr. 9 entflammt eine lebhafte Debatte. Diese lässt
sich anhand der im
Folgenden aufbereiteten Stichproben nachvollziehen.
Authentisch oder
vorgetäuscht?
Nach köstlichem
und umfassenden Gelage glaubt Prof. Heinritz unsere Motivation
im AK_ÖR zu entlarven:
Das neue,
wiederaufkeimende Interesse am ÖR ginge vor allem von der
jungen Mittelschicht aus, welche aus Suburbia in die Stadt zurück
kehrt. Die Leute aus Suburbia hätten in Disneyland die Stadt
kennen gelernt, bzw. ein disneyfiziertes Bild der Stadt.
Dieses Bild tragen sie hinein in die „reale“ Stadt als
Ziel Ihres Suchens und Handelns.
Als Beispiel für eine nach diesen
Idealvorstellungen erbaute Stadt wird das vom Disney Konzern
erbaute celebration city genannt. Ein komplett private
betriebene Stadt. Alles synthetisch, eine dem Konsumierenden
vorgetäuschte Stadt? Prof. Heinritz verweist auf die reale
Existenz des Gebauten.
Im Vordergrund steht der äußere
Schein: Bilder, die eine bestimmte Ästhetik, ein wohl
kalkuliertes Lebensgefühl, historische Tiefe vermitteln
sollen. Ein Genießen an der Oberfläche. Den öffentlichen
Raum auf diesen Aspekt reduzierend, erscheint sein privater
Status kaum als Problem.
Ganz ähnliche
Bedürfnisse scheinen hinter dem Phänomen der Attraktivitätssteigerung
der Städte durch die Rehistorisierung ihrer Innenstädte zu
stecken. Die Städte und ihre öffentlichen Räume werden den
neu gewonnenen Besuchern mundgerecht serviert.
Ein gefährliches
Realitätsdefizit? Die Menschen lernen heute über
aufbereitete, inszenierte Bilder (Fernsehen, Kataloge,
Internet) Ihre Umwelt kennen. Was kann vor diesem Hintergrund
eine authentische Realität sein?
Ist das „sich
in Szene setzen“ nicht ganz normal? Auch für die
Architektur und Städtebau gibt es Vorbilder. Musste die ins
Feld hinaus gebaute und ganz an südländischen Vorbildern
orientierte Ludwigstraße auf den Zeitgenossen nicht auch wie
ein Disneyland wirken? Auch da waren die Stimmungen
vorbereitet und gesteuert.
Disneyland als
Wissensspeicher, als Vervielfältigung von Erlebbaren. Daher
haben die Münchner ihre Kenntnisse der italienischen und
griechischen Baukunst.
Menschen
kommerzialisieren sich, ästhetisieren sich – Räume verändern
sich dementsprechend. (Siehe Diskussion um Privatkapseln)
In der Debatte um private öffentliche
Räume ringen die Teilnehmer darum, mit Ihren Bewertungen
nicht in Heinritz’ ideologische Schublade zu fallen – der
gute und der böse ÖR.
Man ringt um tiefere Argumente, um
dem Misstrauen gegenüber Mall & Co auf die Spur zu
kommen.
ÖR für alle, unwahrscheinlich
„gute Öffentlichkeit“
= höchstmögliche Integration, die Gleichzeitigkeit des
Verschiedenen, viele verschiedene Aneignungsmöglichkeiten
Beobachtung:
Zwischen dem Publikum des Pep und dem der 5 Höfe besteht ein
deutlicher Kontrast. Es handelt sich um 2 verschiedene teilöffentliche
Gruppen. Wobei eine Zugehörigkeit zu beiden nicht so
unwahrscheinlich ist. In der Zeit, d.h. im Laufe eines
Tages/einer Woche kann man an beiden teilhaben – hier zum
zielstrebigen und bezahlbaren Einkaufen, dort zum Schauen und
Erleben.
Ist
Gruppenbildung erlaubt? Ein separater Raum für jede Gruppe, für
jede Tageszeit, für jede Stimmung? Liegt die gewünschte
Vielfalt des ÖR in dem Nebeneinander der spezialisierten Räume
und die Freiheit des Urbanauten in deren Auswahl?
Die Frage
bleibt: findet jeder seinen Raum? Was macht man, wenn die Mall
abends schließt? Was ist, wenn man nicht die Wahl hat
teilzuhaben an den versch. teilöffentlichen Räumen?
Der ÖR hat
klare Standards und Regeln, es gibt ein Regelwerk des Dazugehörens.
Der ÖR sollte sich selber regulieren. Die Straße gibt sich
selbst ihre Normen und Werte.
Im Pep gibt es die
Regeln nach den Interessen der Betreiber (Hausordnung),
private Normen und Werte bestimmen über die Dazugehörigkeit.
Sicherheitsproblematik als Grund für privaten ÖR
Entsolidarisierung der Gesellschaft: Emanzipation (jeder ist
seines Glückes Schmied) soziales Defizit: Normen können im
ÖR nicht durchgesetzt werden (10-Jähriger mit Zigarette)
(Prof. Heinritz)
Sicherheitsdienste und Kameras in
priv. ÖR entsprechen Bedürfnis großer Bevölkerungsschichten,
dabei geht es vor allem um psychologische Sicherheit. Diesbezüglich
schaffen die privaten öffentlichen Räume einen Standard, der
für viele Vorbildcharakter auch für den ÖR hat.
ÖR ist sicher,
wenn hell, lichtdurchflutet, übersichtlich, geordnet –
best. Leute fühlen sich nicht mehr wohl – Sicherheit schließt
aus
Die Überwachung
des priv. ÖR ist niemals umfassend. Es bleibt ein gewisse
Toleranz: eine Mall lässt sich nicht total säubern, das würde
sofort Aufsehen erregen und nicht akzeptiert.
Diskussionsbedarf
Allein die Dosis
macht das Gift
Viele private öffentliche
Räume - welche Konsequenzen hat das für die Gesellschaft?
Warum ist ein Einkaufszentrum als
Mittelpunkt eines Quartiers zu traurig?
Vergleich des Einkaufszentrums mit
einem Platz:
- EZ:
funktionsreduziert, keine eigene Gestaltungsfreiheit, Konsum
zu dominant, Enttäuschung
- Platz:
Anregungspotential viel größer, erzählt Geschichten,
verschiedene Geschichten
ÖR als ein Raum der Freiheit
z.B. die Freiheit, nicht ständig von außen
programmiert zu werden.
ÖR für einen
demokratiefähigen Bürger
Der Bürger kann
im ÖR die Normen und Werte der Gesellschaft erfahren und
lernen (Yvonne)
Weiterdenken
-
Diskurs als Ersatz bzw. Gegensteuerung
zu privaten ÖR (Ben)
-
Körnigkeit von
Strukturen
-
Zeit lassen,
nicht alle Flächen immer optimal nutzen (Prof. Heinritz)
-
Nutzbarmachen von
anderen Frei-Räumen: Platz, Park, Zwischenraum (Agnes)
Agnes Förster
|