
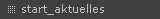 |
 |
 |
|
|
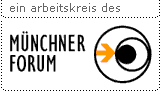
|



Pamphlet #11, nach dem debatten_gelage am 16.6.2003
+++ öffentliche Räume haben eine subjektive Bedeutung +++ der Raum kann Geschichten erzählen +++ kann uns der Raum verbinden? +++ gegen Verinselung und Subjektivierung +++ verbindet uns das Event? +++ temporäre Nutzungen reichen der Raum symbolisch an +++
Abwarten und Teetrinken?
weniger
ein Pamphlet als vielmehr eine Sammlung unbeantworteter Fragen
.... mit einer kleinen Anregung.
Die
schnelle Antwort a là „Symbolkraft muss er haben,
authentisch muss er sein, der eigenen Identität muss er
entsprechen“ war auseinander zu nehmen, denn: Symbolisierung
– Authentizität – Identität, das sind Schlagwörter,
deren Grund es aufzuspüren gilt.
Der Ausgangspunkt - worüber wir reden
Dass
„Raum“ nicht nur materiell ist, sondern immer auch
subjektiv mit Bedeutung aufgeladen wird, scheint Konsens zu
sein. Die interessante Frage ist nun aber eben, nach welchen
Kriterien das geschieht und inwieweit die Gestalt des Raums
– und damit auch des Planers Tätigkeit – überhaupt von
Bedeutung ist.
Einige
Beispiele: In Berlin werden Brachflächen – häufig umzäunt,
allenfalls von Kindern genutzt, ihrer Natürlichkeit wegen Augäpfel
der Naturschützer – derzeit
oft einer temporären Nutzung zugeführt, ob für
Beachvolleyball oder als Künstlerwiese; und auch im Palast
der Republik dürfen momentan Künstler residieren.
Erfolgreiche Projekte, die letztendlich auch strategisch sind;
Ziel: Imagepflege, Symbolverleihung – ein interessanter
Punkt, v.a. auch deshalb weil bei temporärer Nutzung nicht
viel Aufheben um die Gestalt gemacht wird, vielmehr die
Nutzung im Vordergrund steht. Temporäre Nutzungen allerdings
zeitigt nicht die Strategie des Abwartens und Teetrinkens,
sondern sie entspringen gezielter Planung.
Temporär
verschieden genutzt wird auch der Platz vor dem Lenbachhaus in
München – alle erinnern sich höchst gern an den Brunnen
vor dem Tore.
Der
Münchner Marienhof: tja, ob dessen Aneignungskraft sind wir
uns so uneins, dass uns nur eine empirische Studie
weiterhelfen könnte ...
Die
Diskussion um den Bahndeckel auf der Theresienhöhe: hätte
nicht die Umsetzung der preisgekrönten Düne eine einmalige
Identifikationsmöglichkeit geschaffen?
Symbolkraft - der Raum „erzählt“
Ein
Raum, über dessen Symbolkraft wir uns einig sind: der
Marienplatz – allerdings bedeutet er für uns alle das
Gleiche? Oh nein: Touristenmeile, historisches Zentrum, Raum für
Meinungsäußerung – ein Raum kann für vieles stehen.
Symbolkraft heißt, dass der Raum es schafft, uns etwas zu erzählen;
erzählen, das heißt Gemeinsamkeit stiften (jetzt auch mal
rein funktionalpragmatisch betrachtet). Hm`, aber inwieweit
regt die Gestalt Geschichten an? Und: welche Gestalt kann das
überhaupt? Muss sie dazu nicht ganz einfach nur „echt“
sein, „authentisch“?
Authentizität - kann der Raum auch „lügen“
Kann
also die celebration city ganz einfach deshalb nichts erzählen,
weil sie nicht authentisch ist? Was aber heißt denn da jetzt
überhaupt authentisch? Und: erzählt denn die celebration
city tatsächlich gar niemandem etwas? Oder nur uns alteuropäischen
Mittelstandskindern – sind wir vielleicht taub? Oder aber
erzählt sie und lügt ganz einfach dabei? Lügen, d.h. ganz
bewusst den Hörer hinters Licht führen. Da stellt sich dann
die Frage nach dem Akteur, der jemanden zu irgendeinem Zwecke
täuschen will.
Wagen
wir an diesem Punkte einen Blick zu den von Ben D. rezipierten
Soziologen, die von der Erlebnisgesellschaft[1]
zu sprechen belieben, die geprägt ist von einem Objektivitätsverlust
und einem Subjektivitätsgewinn, da für das Individuum nur
noch das Erlebnis zählt, der Event, die medialvermittelte
Welt – soll heißen unser Bild eines gewöhnlichen (?)
Glases viel stärker von den Medien beeinflusst ist als von
unserer realen Erfahrung mit Gläsern. Das heißt dann, dass
unsere Weltsicht eine subjektive, eine medialvermittelte
geworden ist, eine u.U. vereinheitlicht hollywoodisierte.
Genau hier ist wohl der qualitative Unterschied zur doch wohl
schon immer existierenden subjektiven Innenwahrnehmung zu
sehen: die unsrige wird gesteuert von den Medien – fragt
sich natürlich, von wem oder wovon sie früher gesteuert
wurde: Könnte man der Religion derartiges anlasten – nach
dem Motto: früher war eine Pilgerfahrt nach Lourdes Pflicht,
heute eben ein Besuch beim Gemüsehändler von Amélie? Oder
ist es zu sehr in heutigen Kategorien gedacht, wenn wir uns überlegen,
ob nicht etwa auch ein Ägyptischer Pharao sich in Szene
setzte und die subjektive Wahrnehmung seiner Untertanen
beeinflusste?
Interessant
jedenfalls sind die Selektionsprozesse unserer Wahrnehmung –
entspringt nicht etwa unser Ideal eines Platzes Urlaubs- und
Fernseherlebnissen und zeugt somit von unserem allgemeinen
Realitätsverlust? Und was passiert mit der Authentizität,
wenn wir nur noch medial gesteuert sind – und von wem um
alles in der Welt werden wir eigentlich gesteuert, wer steckt
hinter „den Medien“? Was ist dann authentisch, eben genau
die Lüge?
Aber:
sollte die Frage nicht überhaupt ganz anders gestellt werden?
Sollte nicht statt „ist dieser Raum authentisch?“ gefragt
werden „gibt mir dieser Raum die Möglichkeit authentisch zu
sein?“ Doch was wiederum heißt dies?
Identität - das kleine Ich-Bin-Ich
Wenn
eine Person authentisch ist, also ganz Ich sein darf und kann,
nicht Teile ihrer Persönlichkeit verstecken muss, dann bringt
sie doch in ihrer Authentizität ihre Identität zum Ausdruck
– schon wieder so ein Begriff: Identität. Diese bildet sich
in der Auseinandersetzung mit der Welt, mit anderen Dingen.
Was passiert nun, wenn diese nicht authentisch sind? Ein
Teufelskreis? Alles nur noch mediatisiert? Bilden sich dann
„unechte“ Identitäten? Jeder baut sich sein Kartenhaus
und wartet darauf, dass es zusammenbricht?
Andererseits
fühlen wir uns doch ganz gut und nicht wie mediatisierte
Wracks! Naja, dann halt die anderen ... Oder merken wir ganz
einfach nicht, dass sich unsere Identitäten zunehmend durch
subjektive Erlebnisse konstituieren, der gemeinsame Nenner
immer kleiner wird, wir sozusagen verinseln und uns vor dem gänzlichen
Auseinanderdriften nur noch künstliche Anker wie Events
bewahren, die an die Stelle des ursprünglich Gemeinsamen
treten? Doch damit wären wir eigentlich wieder nach dem künstlichen
bzw. dem authentischen .... aus was bestand denn das ursprüngliche
und somit natürliche, echte, authentische Gemeinsame? ....
objektive Welterfahrung ....... war nicht auch die gesteuert?
Die Konsequenzen - was jetzt?
Ja,
was also jetzt? Welche Konsequenzen hat all dies für die
Planung, für die Schaffung aneignungsfähiger Räume? Zunächst
wohl gilt: auf jeden Fall sind derartige gesellschaftliche Veränderungen
mit in die Überlegungen einzubeziehen. Nur wie? Hier gilt es
m.E. weiterzudenken: denn die Strategie des Abwarten und
Teetrinkens ist wohl gerade für Planer keine wirkliche ...
die wären dann nämlich fast schon obsolet ... hihi ... und
ob sie aufgeht, wäre auch noch demonstrandum. Die oben angeführten
temporären Nutzungen tragen den Veränderungen doch gerade in
dem Sinn Rechnung, als dass sie dazu ermutigen, mit dem Raum
zu spielen, mit ihm in Kontakt zu treten, Geschichten
anzufangen, gegebenenfalls ganz individuell und anfassbar –
das muss doch in einer mediatisierten Welt geradezu ein
Erlebnis (!) sein! Entspricht also der Planer als Kurator und
Koordinator genau den heutigen Erfordernissen? Es wäre wohl
durchaus gewinnbringend dies Schritt für Schritt an den
obigen Überlegungen zu überprüfen.
[1]
vgl.: Schulze,
Gerhard (1992) Die Erlebnisgesellschaft. Frankfurt/M.: Campus.