
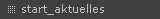 |
 |
 |
|
|
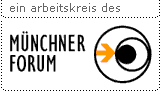
|



Pamphlet #12, nach dem debatten_gelage am 23.6.2003
+++
Geschichte als Ansammlung von Geschichten +++ die kleinen persönlichen
Erlebnisse und Assoziationen +++ Zwischennutzungen können
Orten Geschichte verleihen +++ Provokation und
Diskurserzeugung +++ die kleinen Geschichten verbinden sich zu
einer großen +++ zur
„Gemeinsamkeit“ des öffentlichen Raums +++
I. Mickey Mouse und städtebauliche
Utopie
1975 entwickelte der US-amerikanische Architekt Colin Rowe seine Vorstellung der Collage City. Seine Thesen scheinen schließlich in Theorie und auch in Praxis das Fundament von Walt Disney’s Celebration City gegossen zu haben. Ob Disney sich selbst als Verfechter eines neuen architektonischen und städtebaulichen Stils begriffen hat, mag dahinstehen. Dies aus seinen frühen Werken ablesen zu wollen, scheint wohl ebenso irreal wie ein Comic selbst.
Dennoch mag der Disney-Style im Sinne eines städtebaulichen Comics, d.h. als menschliche Kreation einer artifiziellen Welt, die überdeutliche Anleihen in der Realität nimmt, diese jedoch bewusst überspitzt, mit einem Federstrich Positives auf Hochglanz poliert und Negatives unter den Tisch fallen lässt, eine neue städtebauliche Utopie zu zeichnen und ihr damit Leben einzuhauchen, wie sie Mickey Mouse das Sprechen beibrachte. Während sich Mickey Mouse zu einer über die Utopie hinausgehenden real-künstlichen eigenen Persönlichkeit mauserte, ist fraglich, ob die Celebration City nicht vielmehr einem Frankenstein ähnelt, dem es, obgleich am Leben, an der Seele mangelt. Und sollte sich doch eine solche finden lassen, so müsste sie wohl unzweifelhaft aus pinkfarbener Zuckerwatte bestehen. Verliert also die gebaute und damit nicht mehr utopische Utopie ihren utopischen Charakter, ihre Seele, oder trägt sie nicht vielmehr die Utopie in die Realität und lässt so die Wirklichkeit zu einem (städtebaulichen) Traum werden? Ist die Collage City der strategische Grundriss einer künstlichen Stadtutopie, der Celebration City, in der die Mitglieder der Celebration Generation Künstliches und Kopien als historische Unikate und Authentizität begreifen?
Colin Rowe bemerkte hierzu:
„Gewöhnlich wurde die Utopie, sei sie platonisch oder marxistisch, als axis mundi oder als axis historiae begriffen; aber wenn sie so wie alle totemistischen, traditionalistischen und unkritisierten Ideengebilde wirkte, wenn ihre Existenz poetisch notwendig und politisch bedauerlich war, bestärkt das nur die Vorstellung, dass eine Collage-Technik, die eine ganze Reihe von axis mundi zulässt (alles Taschenausgaben von Utopien – Schweizer Kanton, Neuenglanddorf, Felsendom von Jerusalem, Place Vendôme, Campidoglio usw.) ein Mittel sein könnte, das erlaubt, uns der utopischen Poesie zu erfreuen, ohne dass wir genötigt sind, die Peinlichkeiten utopischer Politik zu ertragen. Mit anderen Worten: Weil eine Collage eine Methode ist, die ihre Tugend der Ironie verdankt – weil sie eine Technik zu sein scheint, gleichzeitig Dinge zu verwenden und nicht an sie zu glauben –, ist sie auch ein Verfahren, das erlaubt, die Utopie als Bildvorstellung zu behandeln, die in Fragmenten zu verwenden ist, ohne sie in toto akzeptieren zu müssen, was weiterhin andeuten soll, dass Collage eine Strategie sein könnte, welche, indem sie die utopische Illusion von Unveränderlichkeit und Endgültigkeit unterstützt, sogar eine Welt der Veränderung, der Bewegung, des Handelns und der Geschichte mit Brennstoff versehen könnte.“[1]
Bezeichnenderweise stellt Rowe dies in einer Zeit fest, in der der (Irr-, Aber- oder Fortschritts-)Glaube starke Wirkung entfalten konnte, die bauliche Architektur sei auch unmittelbare Architektur der Gesellschaft. Dem entgegnet Rem Koolhaas, „die Moderne von Colin Rowe … war um ihr soziales Programm total amputiert, das Soziale war für ihn der Gipfel des Lächerlichen.“[2] Dies zeigt sich insbesondere an Rowe’s Formulierung einer Möglichkeit, sich utopischer Poesie zu erfreuen, ohne den Peinlichkeiten utopischer Politik ausgesetzt zu sein. Was aber ist demnach utopische Poesie, was utopische Politik und deren Peinlichkeit?
II. Utopische
Poesie und Charme der Geschichte
Eine Utopie bezeichnet dem Wortlaut nach den Nicht-Ort, also das, was in der Wirklichkeit keinen Platz hat. Die Poesie stellt die Dichtkunst, also das Wissen um die Formen der Dichtung dar. Wenn sich die Poetik bis weit in die Neuzeit hinein primär an formalen und klassischen Kriterien orientierte, so bindet die Poesie heute ein emotionales Moment in sich und ist vielfach mit romantischen Idealen aufgeladen. Allein die Erwähnung der Städte Paris, Florenz, Venedig, Rom, Nizza oder Sevilla ruft ebenjene Assoziation elegant beschwingter warmer und gefühlsbetonter Atmosphäre hervor, die auch die Poesie allgemein auszudrücken scheint. Wodurch diese Poesie hervorgerufen wird? Es ist sicherlich ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, darunter die Ästhetik klassischer, mediterraner oder auch moderner Architekturformen, deren Belebung und (kollektive?) subjektive Wahrnehmung durch die Menschen, und nicht zuletzt das, was gemeinhin als Geschichte des Ortes verstanden wird.
Im Kreise der Urbanauten fiel in diesem Zusammenhang der Ausdruck „Charme der Geschichte“. Dieser besteht zum einen aus der „großen“ Geschichte der historisch so unverbrüchlichen Ereignisse von Bedeutung, zum anderen aus den vielen subjektiven „kleinen“ Geschichten, also die persönlichen mit dem Ort verbundenen Erlebnisse und Assoziationen. Die Geschichte wird somit zu einer Ansammlung von Geschichten. Dieser Charme ist mit der utopischen Poesie, insbesondere wie Rowe sie versteht, sicher nicht völlig deckungsgleich. Die Ähnlichkeit ist allerdings sehr deutlich, wie auch Rowes Bemerkung bezüglich der Utopie als axis historiae bestätigt. So soll nun im Geiste von der utopischen axis historiae zur Zwischennutzung von Brachflächen nautiert werden.
III. Provokation
als Strategie
Die Urbanautin Förster bezeichnete in diesem Zusammenhang die Zwischennutzung von Brachflächen als Möglichkeit, einem Ort eine Geschichte zu geben. Diese geschichtliche Initialzündung könne bereits vor dem ersten Spatenstich geschehen, etwa mittels eines Diskurses über die Fläche. Gerade die Meinungsvielfalt zu umstrittenen Projekten und Entwürfen wie etwa der Düne an der Schwanthalerhöhe kann dem Ort eine Identität geben, der die Sprachlosigkeit der Individuen aufbricht, sie herausfordert und somit einen öffentlichen Raum im Sinne eines pluralistischen Diskurses (nach Arendt oder Habermas) erzeugt. Die Identität soll dabei in erster Linie über den Symbolgehalt eines Ortes entstehen. Ein prominentes und wohl bereits global anwendbares Beispiel für die Provokation als Strategie sind die Projekte Christos, etwa seine Verhüllung des Reichstages. Um den Diskurs hier aufzugreifen, eine wie ich meine gelungene Marketingaktion, ansonsten jedoch wenig brauchbare Inszenierung.
Zugleich wurde in unserem Kreise die Meinung vertreten, der von der Geschichtsgebung getragene öffentliche Raum als Meinungsstreit trage zu einer Demokratisierung von Kultur (im weiten Sinne) bei. Dem wurde entgegengehalten, dass wenn keiner diesen öffentlichen Raum wolle, er auch nicht baulich oder etwa durch Events oder von Regisseuren des öffentlichen Raumes anderweitig erzeugt werden könne.
IV. Kitt
der Atome?
Während Habermas hinsichtlich des öffentlichen Raumes sprachlich schärfer den „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ behandelt, tituliert Hanna Arendt den Öffentlichen Raum, der hier sowohl das räumlich-physische, als auch die Öffentlichkeit an sich und den Diskurs umfasst, als „das Gemeinsame“[3]. Damit befindet sich der Urbanaut David in bester Gesellschaft, wenn er sagt, Ereignisse im ÖR und dabei insbesondere die Kategorie Events, trügen zu einer in modernen westlichen Gesellschaften verloren gegangenen Gemeinsamkeit der Einzelnen bei. Doch auch die Gegnerschaft ist renommiert, wendet David sich damit doch dezidiert gegen die Utopie Rowes. Dem öffentlichen Raum komme jedenfalls eine soziale Kompensationsfunktion für die Defizite der sich individualisierenden Gesellschaft zu: Kitt für Fragmente und Atome.
Dies sei exemplarisch vorgeführt:
Anlässlich des sich nunmehr zum 15. Male jährenden Events der Celebration Generation schlechthin, der Love Parade in Berlin, zitiert ein Autor mit dem Namen Clemens Pornschlegel jüngst die folgende hymnische Formel:
„Abweichung, Individualität, Differenz, die an ihrer Selbstabschaffung arbeitet, um aufgehen zu können selig im Einen eines Gemeinsamen.“[4] Und weiter: Die Love Parade sei eben jener „Augenblick, wo die Gesellschaft sich als Ganzes sinnlich wahrnahm und bejahte.“
Der Kitt in den Fugen dieser vom Pathos des Pansozialen erfüllten Teilhabermasse einer Großveranstaltung bestehe jedoch gerade darin, sich nicht in irgendeiner Weise überhaupt zu äußern, es sei denn etwa in der Form des erotisch-sinnlichen Einsatzes schöner Unterwäsche, das dem Auge des Betrachters ohne die Tatsachen auf den Tisch zu legen den allgemein bekannten Raum für Interpretation und Phantasie, im Eigentlichen also eine Utopie, eröffnet. Sicher fällt die hier nur angedeutete Sinnlichkeit angesichts der teils rhythmisch, teils scheinbar völlig willkürlich auf der Straße des 17. Juni vorwärtszuckenden Inszenierung nackten Fleisches unter dem Strich eher gering aus. Dennoch ist halt für jeden was dabei, Voyeure kommen ebenso auf ihre Kosten wie die im Rahmen ihrer Bastelbiografien hochgezüchtete Körperlichkeit diverser Kostümträger und Exhibitionisten, inmitten von Mitstreitern und -läufern jeglichen Alters, von altertümelnden Attributen wie Nationalität oder ähnlichem einmal ganz abgesehen. Gerade diese interpretative Konsensfähigkeit des Nichtgesagten, damit nicht Fixierten (Utopischen?), schafft hier das Gemeinsame. Nicht umsonst haben Techno-Lieder meist keinen Text: „Das Mysterium lag in der offensiven Diskursverweigerung.“[5]
Ob also die Neutralität eines Events zu einer erhöhten Akzeptanz und damit Zusammenführung atomisierter Teile der Gesellschaft führt, oder ob nicht vielmehr gerade das Gegenteil, die plakative Stellungnahme und diskursive Auseinandersetzung, hierzu geeignet ist, wäre wohl noch zu erörtern.
V. Öffentlicher Raum als
Kitt: eine Utopie?
Festzuhalten bleiben jedoch folgende Aspekte, Antwortversuche und Anregungen zu der von Geschichten inspirierten und zu Geschichten inspirierenden „Gemeinsamkeit“ des öffentlichen Raumes. Eine Davidsche These, wie immer ketzerisch vorgetragen, fasst nochmals zusammen: der öffentliche Raum sei nicht Selbstzweck, sondern funktional für den Zusammenhalt der Gesellschaft, als Kitt. Wenn also ein Ereignis, um die objektive Dimension zu bezeichnen, im öffentlichen Raum stattfindet, wird dieses als Erlebnis, d.h. subjektiv wahrgenommen und interpretiert. Läuft diese subjektive Dimension kollektiv in dieselbe Richtung, so wird aus den kleinen Geschichten eine große Geschichte mit all ihren subjektiven Nuancen und Erzählweisen.
Weiterhin ziehe der öffentliche Raum, eine von mir selbst vertretene These, bei der ich mich dankenswerter Weise auf die Herren Werlen, Giddens und wohl auch Schulze stützen darf, seine Bedeutung aus der Schaffung eines für alle gleichen Orientierungsrahmens mit seinen Normen und Symbolen und erzeugt somit eine Seinsgewissheit. Diese Dimension bezeichne ich als Normativität und Normalität des Öffentlichen Raumes.
Um noch einen weiteren Schluck neuen Weins aus alten Schläuchen zu degustieren, sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass in der Individualisierungstheorie (v.a. bei Beck) vertreten wird, dass bei grundsätzlich freier Entscheidung des Individuums die Art der Zusammenkünfte (also bestimmte Events) durchaus punktuell gewählt werde, also von manchen Gruppenanhängern nur jene Events besucht würden, von anderen bestimmte andere. Somit entstehen also wieder nur Teilöffentlichkeiten.
Zum zweiten müsse sich das plötzlich freigesetzte Individuum in seiner Entscheidungsfreiheit wiederum an bestimmten Strukturen orientieren, um seinen Platz in der Gesellschaft finden zu können, was Beck als Reintegrationsdimension charakterisiert. Dass man nun nicht unbedingt sein Glück bei einer Sekte suchen muss, die ihre Anhänger glauben macht, die Aliens würden sie mit dem nächsten Kometen schon abholen und mit dem auf dem Mars Gitarre spielenden Elvis bekannt machen, wenn sie nur rechtzeitig Selbstmord begingen, soll nicht darüber hinweg täuschen, dass die Kreation von Lebensstilen und ihren Symbolen gezielt gesteuert wird und auch das Bild des öffentlichen Raumes maßgeblich definiert[6].
Fraglich bleibt, wie stark die Individualisierung und die aus ihr abgeleitete Fragmentierung der Gesellschaft überhaupt ist, ob ein Diskurs sich hier als Kitt eignet und ob und warum denn gekittet werden soll. Dies mag jedoch bei einer neuen Runde Wein diskutiert werden.