
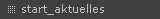 |
 |
 |
|
|
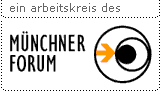
|



und öffentlichen Räumen
Pamphlet #15, nach dem debatten_gelage am 28.7.2003
Gast: Wolfgang Czisch, Münchner Forum
+++ Repertoire und Effekt als Kriterien für die Inszenierung öffentlicher Räume +++ Inszenierung betrifft sowohl den Raum als auch seine Bespielung +++ öffentlicher Raum braucht eine stadträumlich-architektonische Formulierung +++ öffentlicher Raum als Widerspruch und Reibungspunkt +++
Rückblick:
Der Unterschied zwischen Inszenierung und Manipulation
Zu Beginn dieser
Sitzung erinnert urbanautin FÖRSTER an die Diskussion vom
letzten Mal, bei dem es um Inszenierungen ging. Zu Gast war
damals Steffi (Theaterwissenschaftlerin). Die Thesen wurden im
Pamphlet 13 formuliert. Eine Hauptthese war dabei: Alles ist
immer und überall inszeniert. FÖRSTER unterscheidet dabei
zwischen Inszenierung und Manipulation. Inszenierung bedeutet
demnach eine „bewusste Aktion“, bei Manipulation kommt
noch das Berechnende, Beeinflussende dazu.
Inszenierung hat
auch mit Macht zu tun, kann aber auch den viel zitierten
„sozialen Kitt“ darstellen.
Das Wichtige ist der Effekt!
Aufgabe der
Inszenierung ist es, Spontaneität möglich zu machen. FÖRSTER
2003 bringt es auf den Punkt mit dem Satz: „Cool ist es,
wenn’s spontan passiert“.
Am Ende sei der
Effekt wichtig, der sich über den bloßen Inhalt hinaus
ergebe. Das Ereignis als solches ist nichts wert. Attribute
wie gute, oder schlechte Qualität bzw. ein schönes oder hässliches
Ereignis sind als Folge dessen egal, denn es kommt auf die
Geschichten, Ideen, Motivationen an, die sich aus/in einer
Inszenierung ergeben.
Die
heutige Debatte:
Von der baulichen Inszenierung zu temporären
Formen, Öffentlichkeit herzustellen
Wolfgang CZISCH
beginnt die heutige Debatte mit der These: Das Repertoire der
Inszenierung spiele eine große Rolle. Im 19. Jahrhundert sei,
was das Bauliche betrifft, eine klare „öffentliche
Sprache“ existent , die auch Bildung transportierte. Die
heutige, neue Sprache muss demnach erst erlernt werden,
weshalb zur Zeit eine allgemeine Verwirrung um das Thema Öffentlicher
Raum herrscht. SCHRÖPPEL stellt an dieser Stelle die
Verbindung zum Pamphlet No. 13 her, indem sie sinngemäß
sagt, die Lösung für das von CZISCH vorgetragene Problem sei
die Inszenierung; der schon existente gebaute öffentliche
Raum werde neu interpretiert. Auch DAVID hebt hervor,
angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die Öffentlichkeit
aufsplittert, fragmentiert, beschleunigt, virtualisiert (...),
sei die gebaute Stadt zu langsam, um darauf zu reagieren.
CZISCH stellt daraufhin den öffentlichen Raum als Versuch
dar, die „auseinanderdriftende“ Gesellschaft wieder zu
zentralisieren.
Die Gegenüberstellung
von baulicher oder temporären Maßnahmen hält FÖRSTER für
überflüssig. Wichtig sei lediglich, „Geschichte zu
erzeugen“ (s.a. Pamphlet 13).
Bauen mit gesellschaftlicher Zweckbestimmung heute
HARTARD warnt davor, die Propagierung von temporären Inszenierungen dürfe nicht zu einem „Container-Denken“ führen. Zusammen mit CZISCH führt er an: „Der Raum, in dem alles möglich ist, macht keinen Sinn. Es fehlt die Formulierung.“
Es werden
Beispiele genannt, mit denen auch in Moderne und Postmoderne
noch Einfluss auf Gesellschaft genommen wurden (Olympiastadt München
mit dem Idealbild einer echt „sozialen“ Stadt,
Einkaufszentren mit bewusst eingesetzten ausgrenzenden oder
„verkaufsfördernden“ Architekturen) KLAMT spricht in
diesem Zusammenhang von „versteckten Strukturen“.
HARTARD stellt die
These auf, Öffentlicher Raum müsse gegen den Zeitgeist
formuliert werden. Auch andere Diskussionsteilnehmer wenden
sich gegen den „stromlinienförmigen“ Öffentlichen Raum,
der in der Gesellschaft gewissermaßen mitschwimmt, sondern plädieren
für Räume, in und an denen Widerspruch, Reibung und
Interaktion stattfindet.