
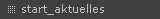 |
 |
 |
|
|
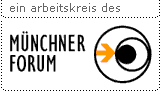
|



Pamphlet #16, nach dem debatten_gelage am 20.10.2003
+++
Die 24 h-Stadt – die Stadt, die niemals schläft +++
Timescapes: neue Funktionstrennung durch Zeitzonen? +++
Nonstop-Stadt Begegnungsstop? +++ Nachtarbeiter, die Stadt und
der Tod +++ Beschleunigung: Investoren am Puls der Zeit,
Planer am Tropf der Investoren? +++ Zeitloser öffentlicher
Raum oder Permanenz als Anker? +++
“Die Geschwindigkeit (der Automobile) veränderte die Ordnung der Dinge, brachte die Bilder zum Fließen. Die neue, höhere Geschwindigkeit in den Straßen forderte eine andere Stadt (...). Und die Bilder und Imaginationen und die neuen Zeit- und Raumwahrnehmungen drangen allmählich in die Mentalitäten der Menschen ein, wenn auch nicht in genormter Gleichzeitigkeit.“
Sid
Auffarth 2002, Die Geschwindigkeit und die Stadt. Der Aufbruch
in die Moderne. In: Klaus Selle (Hrsg.): Was ist los mit den
öffentlichen Räumen? Analysen, Positionen, Konzepte.
Dortmund, S.
103/105
Die
24 h-Stadt
Die
Stadt, die niemals schläft...
Er
will erleben, will konsumieren – und sich dabei nicht von
Ladenschlusszeiten, Sperrstunden oder der letzten U-Bahn
begrenzt sehen.
Nicht
mehr nur der Schichtarbeiter bei BMW arbeitet nachts und am
Wochenende, auch der Softwareentwickler kann sich
traditionelle Ruhephasen im internationalen Wettbewerb nicht
mehr leisten. Nacht- und Wochenendarbeit zieht den
Stand-by-Dienst von Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus nach sich,
Bereitschafts- und Reparaturdienste, 24h-Shops, 24h-Banking,
Lieferpizza, Funk, Fernsehen, Internet, Verkehr(stakt) rund um
die Uhr machen nun (mehr) Sinn, werden notwendig. In Börsen
und Banken wird erstmals Schichtbetrieb eingeführt. Noch
betrifft die Ausdehnung des Non-Stop-Betriebs in die Nacht und
das komplette Wochenende hinein nur eine Minderheit, doch
diese Minderheit wird größer. New York, Tokio oder London
sind bereits kontinuierlich aktiv.
...verändert
Raum: Zurück zur Funktionstrennung?
Diese
Entwicklung von Zeitverdichtung und Zeitausdehnung wird im
Raum sichtbar, der Raum bildet zeitliche Strukturen der
Gesellschaft ab – Timescapes: Stadt spaltet sich in
verschiedene Zeitzonen (24h-Gebiete in Geschäftsvierteln der
New Economy versus Schlafstadtteile, Verkehrsknotenpunkte
versus Ruheinseln etc.) auf, denn zwischen den Funktionen
Wohnen und 24h-Arbeiten entstehen Konflikte (Lärm etc.), die
zu funktionaler Entmischung statt Nutzungsmischung führen
(und uns schaudernd an die Charta von Athen denken lassen...).
...fragmentiert
Gesellschaft?
Kollektive
Rhythmen (sonntäglicher Kirchengang, Signal der Werkssirenen)
sind verloren gegangen, Tagesrhythmen werden individualisiert.
Gemeinsame Zeiten in Partnerschaft, Familie usw. werden
knapper, Zeit wird desynchronisiert. Sozialer Zusammenhalt
jedoch setzt gemeinsame Zeiten und Kalkulierbarkeit von Zeiten
voraus. So haben die entstrukturierte und
enttraditionalisierte Zeit, die veränderten Bewegungsmuster
in Raum und Zeit nicht nur das Fehlen von Erholungs(zeit)räume
für Mensch und Natur zur Folge, sondern auch der
Begegnungs(zeit)raum wird rarer. Letztlich fragmentiert sich
Gesellschaft somit auch zeitlich.
...macht
krank: Nachtarbeiter, die Stadt und der Tod
Nachtarbeit
führt nach Schlaf- und Unfallforschung zu vermehrten Unfällen
(Verkehr, Fabrik, Atomkraftwerke) aufgrund stark verminderter
Reaktionsfähigkeit und Aufmerksamkeit (Biorhythmus) und macht
krank (vgl. Matthias Eberling u. Dietrich Henckel 2002: Alles
zu jeder Zeit? Die Städte auf dem Weg in die kontinuierliche
Aktivität. difu-Beiträge, Band 36).
Thesen aus der Debatte
1. Beschleunigung – Investoren am Puls der Zeit, Planer am Tropf der Investoren?
Planer
verlieren ihr Monopol auf die Produktion von öffentlichen Räumen,
zunehmend gestalten private Investoren Raum. Sie reagieren
schneller auf beschleunigten gesellschaftlichen Wandel und Bedürfnisse/
sind näher am Zeitgeist. Ihr Interesse gilt dem Profit
im/durch ÖR, nicht den gesellschaftlichen Funktionen von ÖR.
Stadt(entwicklungs)planung dagegen ist bemüht, öffentliche Räume
zu planen, die gesellschaftliche Funktionen übernehmen können
(Begegnungsraum, soziale Vielfalt und Sozialisation etc.) und
hinkt den sich beschleunigt verändernden Rahmenbedingungen
strukturell hinterher. Die Planung sieht sich aus Finanznot
sogar gezwungen, im Sinne der Investoren zu vereinfachen, zu
verkürzen und zu deregulieren –
2. „Der zeit-lose ÖR muss planbar sein!“
Wann
ist ein ÖR zeitlos? Wenn Bebauung (Bsp. Mobiles Glasquadrat),
Möblierung, Bespielung flexibel sind, es Raum für Veränderungen
gibt? Flexible Büros (verschiebbare Gipswände etc.) –
Vorbild oder Antibild für den ÖR?
>
Forderung nach offener und flexibler Architektur
Beispiel:
Verschiebbare
Elemente statt permanenter Möblierung od. Mix aus beidem
(z.B. Bänke, die in Sonne oder Schatten gerückt werden können
= Raum für Tageszeiten und Jahreszeiten (veränderter
Sonnenstand) offen lassen/optimalere Nutzung.
oder
der
Frei-Raum, leerer Raum, der offen ist wie ein Gefäß und
extrem flexibel als optimaler
zeitloser
Raum (im Gegensatz zu definiertem Raum, der Nutzungen und
Funktionen weitgehend vorgibt)? Bedeutet die Optionalität der
Zeit eine notwendige Offenheit des Raumes?
Antithese: „Wir brauchen Permanenz des ÖR als Anker in beschleunigter Gesellschaft!“
Im zeitlosen ÖR geht mit jeder Veränderung Geschichte verloren und damit Ich-Verortung und Identifikation seiner Nutzer (und Planer). Permanenz und gesetzliche Verordnungen verhindern ständige Debatte über Veränderungsmöglichkeiten im ÖR – politisch gewollt?
Vera Neuhäuser