
|
|
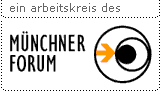
|


Pamphlet #6, nach dem debatten_gelage am 10.3.2003
+++ „Zwischen der Suppe und dem Mund kann sich vieles ereignen“[1] +++ öffentlicher Raum als Suppe +++ Schüssel gleich Stadtraum +++ Einlage gleich Privatkapsel +++ Bouillon gleich innerer Zusammenhalt +++
Ich habe hier nun die Freude, von einem der philosophischeren Kochkurse im ak_ör zu berichten. Um mit dem Ergebnis zu beginnen – unter Umständen haben wir das ultimative Bild zur Beschreibung des öffentlichen Raums entdeckt. Und vielleicht sind mir damit dem schon vor einigen Sitzungen formulierten Zöller‘schen Wunsch nach einer Definition des „öffentlichen Raums“ oder der „Öffentlichkeit“ näher gekommen. Denn die Komplexität des Themas erfordert offensichtlich sehr einfache Bilder – sich da eine simple Bouillon aufzukochen ist da nicht das schlechteste.
Wer andern eine Suppe einbrockt, muss sie auch auslöffeln!
Zu
viele Köche verderben hier keineswegs den Brei. Nach einigen
diskursiven Umwegen der humorvollen Art („ist das Stückchen
Karotte jetzt ein Gespräch, ein Mensch, eine Privatkapsel,
eine gesellschaftliche Gruppe oder eine Umgangsform?“)
gelang es uns das Bild hinreichend klar festzulegen:
ein
Bild für die gebaute Stadt, also quasi der Rahmen der Suppe
oder auch der Rahmen
der Öffentlichkeit und ihrer Diskurse in der Stadt. Weitere
Interpretationen: steingewordene Geschichte, bzw.
steingewordene Diskurse der Vergangenheit. Wenn wir auf die
Theater - Analogie „öffentlicher Raum als Bühne der
Stadtgesellschaft“ zurückgreifen also das Bühnenbild vor
dem sich die zahlreichen Alltagsereignisse abspielen. Hiermit
löste sich auch die Frage in Wohlgefallen auf, ob die gebaute
Stadt oder die sich ereignenden gesellschaftlichen Phänomene
in derselben der entscheidendere Zugang zum Verständnis des
öffentlichen Raums, bzw. der Öffentlichkeit ist. Beides ist
da und beeinflußt sich gegenseitig.
Bei
einer eingehenden Betrachtung der durchschnittlichen
mitteleuropäischen Suppe (hierzu griff ich auf die
freundliche Unterstützung der Forscherkollegen von
www.suppeninstitut.de
zurück)
bestätigte sich dann auch unsere Überlegung vom Montagabend,
dass man die Suppe analytisch in zwei grundsätzliche
Bestandteile zerlegen kann (also „Rückwärtskochen“ um
beim Küchenbild zu bleiben - die dekonstruktivistische
zeitliche rückwärtsgewandte Umkehr des Kochprozesses). Auf
der obersten logischen Ebene stellten wir dabei in einer
immensen intellektuellen Anstrengung fest, aus was sich die
Suppe eigentlich zusammensetzt: aus vielen verschiedenen
einzelnen festen Stückchen und aus der alles verbindenden flüssigen Brühe oder
auch Bouillon. Ob
das auch das ist was die Suppe ausmacht? Dazu später mehr?
Die
Stückchen in der Suppe taugen als Bild für die vielen
einzelnen Akteure oder auch für einzelne Gruppen (je nach Maßstab
quasi) im öffentlichen Raum. Sie sind zwar elementare Zutat
der Suppe. Ohne die alles verbindende Bouillon wären Sie
allerdings wenig suppenhaft.
Das,
was die Suppe in ihrem Inneren zusammenhält. Eine Suppe ohne
Brühe oder Bouillon wäre wohl kaum noch als Suppe zu
bezeichnen. Genauso wie der öffentliche Raum ja wohl auf
jeden Fall irgendeine Form von Interaktion zwischen den ganzen
„Privatkapseln“ braucht und ermöglicht. Hier konzentriert
sich die Diskussion: Was ist es eigentlich was die ganzen
einzelnen Teile im öffentlichen Raum zusammenhält. Wofür
steht in unserem Bild also die Bouillon? Während ja die Stückchen
recht gut zu fassen und zu beschreiben sind ist es bei der
Bouillon aufgrund ihres flüssigen Naturells weit schwieriger.
Und
dann: Wofür steht also in unserem Bild die Bouillon? Grundsätzlich
war unser Gefühl, dass all diese einzelnen Bausteine dazugehören?
Also sowohl die Themen, als auch die Art wir über sie
gesprochen wird. Ich fühle mich dabei auch ziemlich stark an
den Begriff Diskurs erinnert. Aber weiter sind wir hier nicht
wirklich gekommen. Vielleicht eine Idee für unsere nächste
Sitzung.
Und
dann stellt sich noch die Frage: Wofür stehen dann das
„Salz in der Suppe“ und dementsprechend das „Haar in der
Suppe“, wofür der Löffel, der Herd, der Tisch, der Koch
und sein Kochlöffel, wofür das Rezept, der Geschmack, die
Erwartungshaltung, die verschiedenen Konzepte von Suppe...?
Das
Bild wäre noch ganz schön ausbaufähig! Aber ich will zunächst
versuchen mit einem Beispiel, das Bild auf seine Tauglichkeit
zu testen.
Klar
wir Kloßbrühe?
Ein kleiner Thesentest in Form einer Bild-Analyse
So
hatten wir ja gesagt es gibt verschiedene Einzelbestandteile
(„Stückchen“, sonst auch gerne „Privatkapsel“
genannt) im öffentlichen Raum: auf unseren beiden Bildern
also die verschiedenen Personen oder auf dem unteren auch 2
PKW älterer Bauart. Außerdem gibt es so etwas wie den Rahmen
der Handlung (a.k.a. „Schüssel“) – also die gebaute
Stadt: hier in Form einer Häuserecke, vor dem Café, an der
Straße, vor bedeutenden Gebäuden, auf dem Bürgersteig.
Dies
sind die Dinge die wir auf den ersten Blick sehen, genauso wie
wir beim Betrachten der Suppentasse rechts unten auch zunächst
die Tasse und dann die vielen Stückchen sehen, die an der
Oberfläche schwimmen. Allerdings der große Charme der
photographierten Situation entsteht auf einer anderen Ebene:
durch die starrenden Blicke der Männer und die Pfiffe, die
man sich geradezu vorstellen kann, durch die Bewegung der
Anderen hinter dem küssenden Paar (Space of Flows?), durch
die fast schon nachvollziehbare abweisende Geste des
„american girl“, durch die konfliktgeladene Konnotation
„American girl in Italy“, durch das 50er Flair, durch die
theatralische Aufstellung der Männer um den Weg der schönen
Frau, durch deren Blickrichtungen, die neckische Kopfhaltung
des jungen Herren auf der Vespa, durch die Starrheit des
Aktentaschenträgers im Knutschphoto oder die fast schon
voyeuristische Position des Dandys links unten in der Ecke
oder den zugewandten Rücken des Herrn mit dem schwarzen Hut,
...
Hier reden wir also über die Bouillon! Und wir stellen fest das diese Dinge nur greifbar sind, weil mit dem Photo ein Stillstand der sonst bewegten Situation künstlich hergestellt wird. Die Zeit wird für uns angehalten – und erst dann können wir uns all dieser verknüpfenden, metaphysischen Dinge bewusst werden (Interaktion, Aufeinanderprallen, Gegensätze, etc.). Und dann kommen wir nämlich auch zu der 3. Ebene. Handelt es sich hierbei um Funktionen des öffentlichen Raums, Nutzungen, Ideale davon, Trugbilder, Wunschvorstellungen...
Kein
Wunder also, dass sich unsere Debatten schwierig gestalten.
Denn wir wissen noch nicht einmal worüber wir reden,
geschweige denn, ob wir, wenn wir es versuchen, vom gleichen
reden (können). Sprich, es gibt noch viel auszudiskutieren!
"You've
got to struggle against the pollution of intelligence in order
to become an animal with very sharp instincts - a sort of
intuitive medium - so that to photograph becomes a magical
act, and slowly other more suggestive images begin to appear
behind the visible image, for which the photographer cannot be
held responsible."
Vielleicht
auch eine Anregung für unsere weitere Diskussion. Ich bin
jetzt erst einmal mit meinem Küchenlatein am Ende. Im
Anschluss noch von den Kollegen von www.suppeninstitut.de
eine kleine Kulturgeschichte der Suppe, die ich Euch nicht
vorenthalten will.

Kleine
Kulturgeschichte der Suppe
www.suppeninstitut.de
Ein
anderes lebendiges Fossil der Küchengeschichte begegnet uns
im "Pot au feu", dem ewig siedenden Kochtopf, in dem
sich alles sammelt, was der Tag und das Jahr bringt: Gemüse,
Fleisch, Wurzelwerk, das jedesmal eine andere Nuance annimmt,
jedoch immer das gleiche bleibt und sich stets erneuert. Für
jeden ist immer etwas da. Die Suppe hat Urtugenden: Sie
wartet, sie erneuert sich, sie wird bei jedem Aufkochen
besser, sie kann sich wandeln.
Suppe
ist ein Essen für viele: Die Technologie des Kochtopfes
entwickelt im Mittelalter den 100 Liter-Topf aus Eisenblech.
Das Geheimnis jeder guten Suppe wird dadurch bedingt, dass sie
ganz langsam lange gart, die Zutaten allmählich zu einem
Ganzen amalgieren und aus der Alchemie einfacher Zutaten etwas
vollkommen Neues erwächst.
Suppe als hoffähige Speise
Suppe
als Wunder der Ökonomie
Den
barocken Festfreuden folgten die vernünftigen, strengen
Prinzipien der Aufklärung. Hier erfuhr Suppe ihre
Neuinterpretation. Sie wurde zur Vernunft gebracht, und was
ist vernünftiger als Suppe, ein Wunder der Ökonomie, Mittel
des "social engineering"! Dem bayerischen Grafen
Rumford, als britischer Untertan Benjamin Thompson (1753 -
1814) in Massachusetts geboren, gelang der große Schlag:
Nachdem er zuerst die Wärme - Theorie von den bewegten Molekülen
formuliert (1798) und konsequent den geschlossenen Herd
erfunden hatte, ging er daran, die Massen zu speisen. Nach
kalorischen, ergonomischen, physiologischen Berechnungen
konnte dies nur eine minimalische Gemüse-Graupensuppe sein,
die fortan in den Armenküchen, Suppenanstalten und Feldküchen
Europas als "Rumfordsuppe" von der Obrigkeit
verabfolgt wurde. Zwischen sozialer Wohltat und kulinarischem
Zynismus verschwand so jeder Unterschied.
Der
große deutsche Kunsthistoriker und Gastrosoph Carl Friedrich
von Rumohr (1785 - 1843) kennt die Rumfordsuppe, zieht ihr
aber seine vereinfachte "Olla podrida" vor, um sich
von der fetten, völlig überwürzten Küche seiner
Zeitgenossen zu befreien und davon zu heilen. Dass Suppe
gesund sein kann, war eine Grunderkenntnis der Aufklärung,
und der Maler Jean-Baptiste Chardin (1699 - 1749)
verherrlichte in seinem Küchen - Stilleben die Elemente einer
guten Fleisch-Gemüsebrühe.
Von
der Suppe zum Restaurant
Eine
treffliche Bouillon war auch die "Ursuppe" der
Restaurants. "Restaurant" hieß ursprünglich ein
Consommé, das in Paris kurz vor der 1789er Revolution als
eine die Kräfte wieder herstellende Gesundheitssuppe
verschiedentlich in öffentlichen Garküchen auf Einzeltischen
den Gästen angeboten wurde und bald diesen neuen
Institutionen den Namen gab. Und tatsächlich war das
Geheimnis der vielen köstlichen gebundenen und klaren Suppen,
der Unzahl von Saucen, Aspiks, Gelées und
Fleischzubereitungen eine Suppenbrühe, die in einem großen
Topf brodelte. Dies war der Ursprung aller
Gastronomie-Geheimnisse des XIX. Jahrhunderts. Der Fonds war
die Basis der "Grande Cuisine" von Carême bis
Escoffier, der Grundstoff aller Raffinements. Entweder eine
Morchel, ein Krebsschwanz, dünne Trüffelscheibchen, ein
Schuss Sherry oder Madeira, eine Prise Safran oder etwas
Kerbel: Schon wird aus einem Fonds eine Köstlichkeit.
Nichts
lässt sich schneller aufwerten als eine Suppe. Die Ökonomie
des Luxus in der Küchenkunst findet ihre Antwort in den
Suppen. Suppen sind par excellence Familienessen, Leibspeisen
und Nationalgerichte. Sie dienen der ldentitätsfindung von
Personen oder Gruppen beim Teilen des gemeinsamen Mahls: die
holländische Erwtensoep, der Hotchpotch, die spanische Olla
podrida, der argentinische Puchdro, die serbische Bohnensuppe,
die italienische Minestrone, der deutsche Pichelsteiner Topf,
die belgische Waterzoi sind die heimlichen Lieblingsspeisen.
Suppen sind wahre Wunder, wenn es darum geht, sich mit den
Essern zu arrangieren: Mit der Zeit werden Suppen immer
besser, auch in der Kulturgeschichte nehmen sie ganz den
Charakter ihrer Epoche an.
Autor: Dr. Hans Ottomeyer (Historiker)
Staatliche Museen Kassel
Postfach 410 420, 34066 Kassel
