
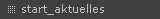 |
|
|
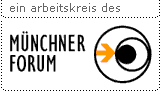
|


Pamphlet #7, nach dem debatten_gelage am 14.4.2003
+++
Salz in der Suppe +++ was macht den öffentlichen Raum
schmackhaft?
+++ „offene“ oder „definierte“ Räume +++ Bank, Baum,
Brunnen +++ eine gemeinsame Suppenschüssel +++ ein Raum für
jede Zielgruppe +++
Salz
in der Suppe
Über die Suppenschüssel und die einzelnen Karotten, Kartoffeln und anderen Bestandteile haben wir diesmal weniger geredet (siehe Pamphlet Nr. 6, Benjamin David). Weniger ein intelektueller Kochkurs als ein Exkurs über die Unterschiede von Meersalz, Jodsalz, Himalayasalz, Es ging über „offene“ und „definierte“ Räume, über Zielgruppen und deren Sichtweisen, Ansprüche und Wünsche an den öffentlichen Raum – wenn man so will ist das Salz in der Suppe....
Gefahr, Aneignung, Besetzung?
Ein einfaches Beispiel: Es wird Frühling, die Sonne scheint, Kinder spielen auf der Straße Fußball, Kästchenhüpfen, tanzen und tollen, lachen und schreien.
Wie ist das zu bewerten? In jedem Einzelfall anders? Mal gut, mal schlecht, mal gefährlich? Aus jedem Blickwinkel anders? Aneignung, Besetzung, Inszenierung? Oder haben sogar alle auf ihre weise recht? Wovon hängt die Bewertung dieser Frage ab? Von Erziehung, Sozialisierung, Gesellschaft, dem Hintergrund jedes einzelnen Betrachters?
Zugegeben, das Beispiel hat einige Schwächen, natürlich ist es gefährlich auf dem Mittleren Ring Fußball zu spielen, aber in der Zone 30 vor seinem Haus ein paar Bälle zu kicken, wo eh nur alle vier Stunden ein Auto vorbeirollt, da scheiden sich schon die Geister.
Qualität, aber welche?
Kann man den öffentlichen Raum über seine Qualitäten definieren? Dabei müßte man sicherlich die unterschiedlichen Zielgruppen betrachten. Für wen/welche Situation plant man öffentlichen Raum mit welchen Qualitäten? Freie Zugänglichkeit kann des einen Freud und des anderen Leid sein. Besteht da nicht die Gefahr, dass zu viele Gruppen nicht berücksichtigt werden? Die, die sich schwer artikulieren können oder keinen Einfluß auf die Politik nehmen (kein Wahlrecht, kein Geld ...).
Fragt man „die Bürger“, was sie wollen, so werden meist die drei 3 B’s genannt:
Doch auf der Bank liegen die Penner, also werden sie gar nicht gebaut, der Brunnen ist zu teuer, und so bleibt meist nur ein Baum....
Ist die Schüssel egal?
Zurück zum Kochkurs: ist der Raum, die bauliche Gestaltung und die Häuserfronten, die Silhouette, die Fassaden, die Kulisse ja die Umgebung (Suppenschüssel) egal? Ist das einzige was zählt das Individuum? Wie einzelne Personen den Raum wahrnehmen, sehen, empfinden interpretieren? Sucht sich also jeder „seinen“ öffentlichen (Aufenthalts-) Raum und ist der Raum dann noch der Spiegel der Gesellschaft? Muß jeder Raum also nur auf eine Zielgruppe zugeschnitten sein bzw. jeder eignet sich seinen eigenen Raum an und deshalb ist die Planung obsolet?
Offener Raum oder definierter Raum?
In der aktuellen Stadtplanungsdiskussion gibt es beide Strategien und beide finden sich auch in kürzlich umgestalteten Plätzen wider (Georg-Freundorfer-Platz und Rindermarkt s.u.). In offenen Räumen ist alles möglich, sie sind nutzungs- und ergebnisoffen. Doch hängt das mit der „Hilflosigkeit“ der Planung zusammen? Kein Mensch weiß, wie die überplanten Gebiete angenommen werden, deshalb läßt man möglichst viel Freiraum? Oder gar mit der fatalen Situation der städtischen Finanzen?
Beispiele aus München
Ein Beispiel für einen offenen Raum ist der umgestaltete Rindermarkt. Dieser ist laut Baureferat zu einem neuen Startplatz, der großzügig und urban in der Art einer italienischen Piazza, umgestaltet worden. OB Ude betont, dass gerade kein idyllischer Einödhof mit Geranien entstehen sollte (vgl. SZ 3./5.12.02).
Wie könnte es weitergehen?
Alles klar wie Kloßbrühe? Ich denke die letzten beiden debatten haben gezeigt, dass wir erst am Anfang der Diskussion stehen und die Suppe noch lange nicht ausgelöffelt haben. Zu klären ist noch die Boullion Frage (siehe Pamphlet Nr. 6), also der Diskurs über den öffentlichen Raum und welchen Einfluß er auf die Individuen und ihre Haltung zum öffentlichen Raum hat, zum anderen die Frage des Einflusses der Schüssel.
Kleine Notizen am Rande:
Josephsplatz: am Wochenende verwandelt sie der Münchner Josephsplatz zum Treffpunkt der Russen. Wer mal seine Sprachkenntnisse erweitern will, oder nur für ein paar Augenblicke Moskau, kann da mal vorbeischauen.
Buchhandlung in der Rumfordstr./Baaderstr. bietet monatliche Exkursionen in verschiedene Stadtviertel an. Schaufensterspruch „die Stadt muß gelesen werden wie ein Satz“
Exkursion der urbanauten in das Stadtmuseum zur Geschichte der Stadt, historische Bilder, das neue Holzmodell von München, 3D - Darstellung von München aus verschiedenen Jahrhunderten
Uli Schröppel