
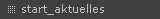 |
|
|
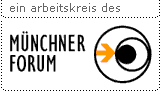
|


Pamphlet #8, nach dem debatten_gelage am 28.4.2003
Gast: Professor Dr. Claus-Christian Wiegandt, Universität München
+++ Planbarkeit der Nutzung +++ der Stellenwert des Gebauten +++ Gestaltung der Bedürfnisse der Städter +++ reizvolles Zusammenspiel der Nutzungen +++ Ereignisse laden in den öffentlichen Raum ein +++ sozialisiert zum Flaneur? +++
Suppe
Flanieren
und nicht passieren
Sehen und gesehen werden, sich inszenieren, zur Schau stellen – auch das sind zentrale Funktionen des öffentlichen Raums. Auch dabei spielt die bauliche Gestaltung eine untergeordnete Rolle. Wichtiger sind dann die Menschen/die Gesellschaft, von denen man gesehen werden will oder zu denen man eine klare Abgrenzung sucht.
Sozialisierung
Über die immer noch im Raum stehende These, dass die „reichen Viertel“ in Bezug auf die Nutzungen im öffentlichen Raum ein Defizit aufweisen (vgl. Pamphlet No.2), entwickelte sich die Frage, ob und inwieweit die Sozialisierung der Personen Einfluss auf die Nutzungen/ das Interesse im/am öffentlichen Raum hat.
Zum einen wurde die These vertreten, dass der kindliche Lernprozeß und die Erziehung eine prägende Wirkung auf das individuelle Verhalten im öffentlichen Raum hat. Zum anderen wurden wieder die unterschiedlichen Mentalitäten der Menschen ins Feld geführt. Ulrike S. ist keine brennende Verfechterin dieser Betrachtungsweise. In Bezug auf die Nutzung des öffentlichen Raums in wohlhabenden Vierteln bzw. in Deutschland im Vergleich zu südlicheren Ländern wie Italien, die oft als Idealbild herangezogen werden, scheinen ihrer Meinung nach andere Faktoren eine wichtigere Rolle zu spielen. Da ist zum einen eine dichtere Bebauung zu bedenken, wenn Menschen nicht die Möglichkeit haben, sich in ihren eigenen Garten zurück zu ziehen und zum anderen gibt es nicht so zahlreiche Ausweichmöglichkeiten in öffentlichen Räumen. Die Wohnungen sind oftmals kleiner und der Drang, sich aus dem Weg zu gehen, ist daher größer – so bietet der nutzbare öffentliche Raum eine gute Möglichkeit, sich mit Bekannten zu treffen.
Lob
& Tadel
Lob und Tadel ist die neue Feedbackrunde am Ende eines jeden debatten_gelages. Dadurch können wir die Diskussion noch mal kurz reflektieren und überprüfen, ob wir die uns gesteckten Ziele annähernd erreicht haben. Solche Runden sind ja sicherlich allgemein bekannt, aber noch mal kurz die Spielregeln:
Lob
- Diskussion wird ernsthafter (Niveausteigerung)
- offene, freie und abstrakte debatte am Montag abend